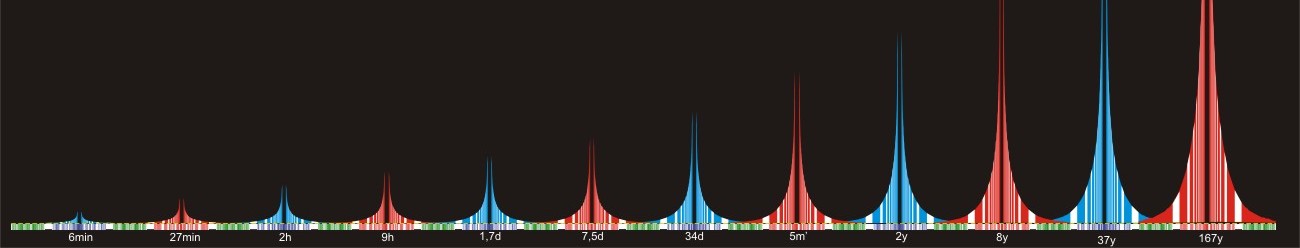Quelle: bidok.uibk.ac.at, Gertrud Köck
Chaostheorie
Aspekte für die Pädagogik
Releaseinfo: Diplomarbeit zur Erlangung eines Magistragrades der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. eingereicht bei: a.o. Univ. – Prof. Dr. Volker Schönwiese, Betreuung: Univ.-Vetr. Ass. Mag. Sigrid Köck-Hatzmann, am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. Breitenwang, März 1999
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 PERSPEKTIVENWECHSEL
- 2.1 EIN WELTBILD IM UMBRUCH
- 2.1.1 Das griechische Weltverständnis
- 2.1.2 Das jüdisch-christliche Weltverständnis
- 2.1.3 Das mechanistisch – kartesianische – newtonsche Weltverständnis
- 2.1.4 Der physikalische und psychologische Determinismus
- 2.1.5 Das neue Weltbild der Naturwissenschaften
- 2.1.6 Das holographische Weltbild
- 2.1.7 Das chaostheoretische Weltbild
- 2.1 EIN WELTBILD IM UMBRUCH
- 3 CHAOS
- 4 VON DER ORDNUNG ZUM CHAOS
- 5 VOM CHAOS ZUR ORDNUNG
- 6 RHYTHMUS
- 6.1 RHYTHMUS – GESCHICHTLICHE ÜBERLEGUNGEN
- 6.2 RHYTHMIK – EIN DIALOGISCHES PRINZIP
- 6.3 RHYTHMUS – LERNEN DURCH BEWEGUNG
- 6.4 RHYTHMUS – BEWEGUNG ZWISCHEN INNEN UND AUSSEN
- 6.5 RHYTHMUS – ZEITRÄUME
- 6.6 RHYTHMUS – DER INBEGRIFF ALLEN LEBENS
- 6.7 RHYTHMUS – EIN KÜNSTLICHES KONSTRUKT
- 6.8 RHYTHMUS – BEDEUTUNG FÜR DIE FLIESSGEWÄSSER
- 7 DIALOG
- 8 GLOSSAR/CHAOSTHEORIE
- 9 GLOSSAR / FLIESSGEWÄSSER
- 10 LITERATUR
- LEBENSLAUF
Mit vorliegender Arbeit versuche ich mich mit verschiedenen Begriffen aus der Chaostheorie auseinanderzusetzen und ihre Bedeutung für die Pädagogik zu erfassen.
Die Begriffe stammen aus den naturwissenschaftlichen Richtungen, wie z.B. Mathematik, Physik, Chemie u.a.. Das bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich, da für mich als Geisteswissenschaftlerin diese Bereiche zuerst einmal fremd sind. ich beschränke mich deshalb auf jene Begriffe, die mir in ihrer Bedeutung für die Pädagogik grundsätzlich erscheinen. Mit verschiedenen Bildern, versuche ich Begriffe aus den verschiedenen Gebieten transparenter zu machen.
In den Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie gibt es erstaunliche Erkenntnisse, die grundlegend für die Sichtweise eines neuen Weltverständnisses sind. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen einer reduktionistischen Denkweise und einem Ganzheitsdenken steht am Beginn meiner Arbeit.
In unserem Alltagsgebrauch bedeutet der Begriff „Chaos“ meist das Gegenteil von Ordnung. Für Chaostheoretiker jedoch ist dieses Wort zu einem Sammelbegriff geworden, der für eine umfassende Arbeitsrichtung innerhalb nichtlinearer dynamischer Systeme steht. Lebende Systeme sind in ihrer Entwicklung im Prinzip unvorhersagbar. Diese Erkenntnis halte ich für die Pädagogik von grundlegender Bedeutung. Pädagogen werden zu Begleitern von Erziehungsprozessen. Das Kind ist nicht mehr Objekt, das aufzunehmen hat was der Lehrer vorgibt, sondern es wird zum Partner, das die Auswahl seiner Lernschritte selber trifft.
Entwicklung zu beschreiben und zu erklären, scheint mir ein komplexes Unterfangen. Entwicklung verläuft meines Erachtens nie eindimensional, d.h. linear, sondern multidimensional, mit Brüchen und Widersprüchen.
Der Mensch ist ein sich selber organisierendes System. Wie jedes andere lebende System, entwickelt er sich durch ständige Selbsterschaffung, Strukturveränderung und Anpassung. Entwicklung verlangt und erfordert Dialog. Der Dialog hat im Vergleich zur Kommunikation und Interaktion eine besondere Beziehungsqualität oder wie R. Spitz es ausdrückt: „Leben im menschlichen Sinn kann nicht asozial, es muss sozial sein.“ (Spitz 1988, S.23)
Motivierend für meine Arbeit war vor allem meine persönliche Neugier. Die Auffassungen, zu denen ich gekommen bin, sind nicht die einzigen entwicklungs-theoretischen Lösungen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei allerdings meine Überzeugung, dass nicht das Ergebnis das Wesentliche ist, sondern der Weg. Dies entspricht meiner persönlichen Lebenserfahrung.
Damit dem Leser dieser Arbeit der Umgang mit den verschiedenen Begriffen aus der Chaostheorie leichter fällt, habe ich im Anhang ein Glossar erstellt. Ebenso für die Begriffe aus der Hydrologie, da ich öfters Bilder verwendet habe, die aus der Gewässerbiologie stammen.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1 EIN WELTBILD IM UMBRUCH
- 2.1.1 Das griechische Weltverständnis
- 2.1.2 Das jüdisch-christliche Weltverständnis
- 2.1.3 Das mechanistisch – kartesianische – newtonsche Weltverständnis
- 2.1.4 Der physikalische und psychologische Determinismus
- 2.1.5 Das neue Weltbild der Naturwissenschaften
- 2.1.6 Das holographische Weltbild
- 2.1.7 Das chaostheoretische Weltbild
In den Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie gibt es erstaunliche Beobachtungen. die grundlegend für die Sichtweise eines neuen Weltverständnisses sind.
Seit dem 17. Jahrhundert gibt es in der europäischen Geistesgeschichte eine Auseinandersetzung zwischen Reduktionismus und Ganzheitsdenken. Diese Auseinandersetzung wird sich wahrscheinlich noch weiter fortsetzen. Dabei fällt der Philosophie die wichtige Aufgabe zu, Ethik in die Wissenschaft einzubringen.
Seit frühester Zeit ist die Menschheit gewohnt, die Unordnung, das Chaos, aus der Sicht der Ordnung zu beschreiben. In der Schöpfungsgeschichte wird genau aufgezählt, wie Gott die Ordnung aus der Finsternis – aus dem Chaos – ins Licht, in eine Ordnung gebracht hat. Aus Chaos wird Ordnung geschaffen.
„Eine alte Tradition besagt, die Philosophie habe mit Thales von Milet begonnen einem klugen Mann aus der Handelsstadt Milet im griechischen Kleinasien. Er habe dort im 6. Jahrhundert v. Chr. als erster Mensch begonnen zu philosophieren. Dieser Thales von Milet fragt sich: Was ist das Wesen von alledem, woher kommt, woraus entspringt alles? Was ist der Ursprung von allem? Was ist das Eine, alles Umfassende, das Prinzip, das macht, daß das alles wird und ist und besteht?
Das sind, wenn auch von ihm selber nicht so ausgesprochen, die Grundfragen des Thales, und indem er sie als Erster stellt, wird er zum Anfänger der Philosophie. Denn nach dem Wesen und nach dem Grund zu fragen, ist seitdem und bis heute das zentrale philosophische Anliegen.“ (Weischedel, S. 14)
„Das Bewegte, die Bewegung selbst, ist das Wirkliche, sagte Heraklit. Das Unwandelbare, das Immerseiende ist das Wirkliche, widersprach Parmenides. So ergaben sich zwei neue Grundbegriffe und ein neues Problem der Philosophie: Wandel und Unveränderlichkeit.“ (vgl. Theologischer Fernkurs, S.1ff)
Im Folgenden soll auf einige unterschiedliche Weltverständnisse und Weltbilder der abendländischen Geschichte hingewiesen werden, da sie unmittelbare Folgen für menschliches Handeln haben, in diesem Zusammenhang im besonderen mit unserem Handeln als Pädagogen. Das Weltbild verändert das Menschenbild – mithin auch das Bild, das wir uns z.B. über Menschen mit Behinderung, Entwicklungsbeeinträchtigung und psychischen Erkrankungen machen können.
Im griechischen Weltverständnis wird die Welt als Kosmos verstanden. Das meint zunächst Weltall, Universum als Gesamtheit des Wirklichen. Zugleich liegt im Wort „Kosmos“ die Bedeutung von Ordnung. Die ursprüngliche Bedeutung geht aus vom unmittelbaren Erfahrungsumkreis des Menschen: die Ordnung des Heeres, aber auch die gegliederte Ordnung der übrigen menschlichen Lebensbereiche ist angesprochen. Diese im menschlichen Bereich erfahrene Ordnung wird auf das Weltall ausgeweitet. So wird Welt im Ganzen von der unmittelbaren menschlichen Lebenswelt her ausgelegt und verstanden.
Kosmos ist so die schöne, harmonisch gegliederte Ordnung, aber als eine Einheit von Gegensätzen. Der ganze Kosmos ist vom Logos durchwaltet. Er hat eine Sinnstruktur, die nicht wir in ihn hineintragen, die wir aber wohl in Grenzen entdecken und erkennen können. Wie der Kosmos im Ganzen, so sind auch die menschliche Gemeinschaft und der einzelne Mensch vom gleichen Logogs durchwaltet. Das Ordnungsprinzip des Weltalls, der menschlichen Gemeinschaft und der menschlichen Einzelseele ist ein und dasselbe. So kann auch menschliches Zusammenleben nicht in Ordnung sein, wenn nicht die kosmische Ordnung verwirklicht ist.
Der Kosmos ist etwas Heiliges, zugleich naturhaft und göttlicher Bereich, Erscheinungsform des Göttlichen. Die angemessene Zuwendung ist das Schauen, die reine Theorie, das Betrachten der Schönheit und Ordnung der Welt.
Das jüdisch-christliche Weltverständnis unterscheidet sich sehr vom griechischen Kosmosverständnis. Danach ist die Welt die Schöpfung und das Werk Gottes. Welt ist selbst nicht Göttliches, sondern etwas von Gott Gemachtes, und zwar auf den Menschen, die Krone der Schöpfung hin Gemachtes. Welt hat Anfang und Ende. Welt ist der Raum für die Geschichte Jahwes mit seinem Volk. Welt wird als Geschenk und Auftrag Gottes gesehen.
Aus alledem wird deutlich: Wo Welt als Auftrag Gottes an den Menschen verstanden wird, kann der Mensch mit ihr sehr viel anders umgehen, als dort, wo er die Welt als göttlich zu verehren hat.
Die entzauberte und dem Menschen anvertraute Welt wird zugleich die vom Menschen verwertbare Welt. Natur wird zur Vorratskammer für alle Arten von Rohstoffen. Sie dient dem Menschen und bietet ihm alle Möglichkeiten des Umgangs mit ihr. Vom Wandel einer Naturlandschaft bis hin zu einer Kulturlandschaft ebenso, wie die Manipulation von pflanzlichen, tierischen und menschlichen Genen.
Das „mechanistisch-kartesianische Weltbild“ bzw.“kartesianisch-newtonsche Weltbild“ hat die Naturwissenschaften seit dem 17.Jahrhundert bestimmt. Geprägt wurde dieses Weltbild durch Galilei, Descartes und Newton.
Galileo Galilei (1564 – 1642):
G. Galilei, italienischer Naturforscher und Philosoph, benutzte als erster die Mathematik zur möglichst präzisen Formulierung von Naturgesetzen. Er fordert, dass die Wissenschaft sich auf die Untersuchung meßbarer und quantifizierbarer Eigenschaften von Körpern zu beschränken habe.
Galilei wurde neben seiner Entdeckung der Fallgesetze vor allem durch seine Leistungen in der Astronomie berühmt. Mit seiner Erfindung des Fernrohrs gelang es ihm, aus der Kosmologie eine gültige Wissenschaft zu machen. Dies führte zu einem Zusammenstoß mit der Kirche. Er gilt als Vater der modernen Wissenschaft, da es ihm gelang, wissenschaftliche Experimente mit der Anwendung der mathematischen Sprache zu verknüpfen. In der Philosophie müssen wir die Sprache und die Schriftzeichen erlernen mit denen sie geschrieben steht, damit wir sie verstehen können. Diese Sprache ist Mathematik, und die Schriftzeichen sind Dreiecke, Kreise und sonstige geometrische Figuren, so glaubte Galilei.
Damit die Wissenschaftler die Natur mathematisch beschreiben konnten forderte er sie auf sich auf das Studium der wesentlichen Eigenschaften materieller Körper zu beschränken: Formen, Zahlen und Bewegung mussten gemessen und qualifiziert werden. Sinnesqualitäten (z.B. Farben, Temperaturen, Gerüche etc.) waren für ihn keine objektiven Eigenschaften der Dinge selbst, sondern subjektive Projektionen, die aus der wissenschaftlichen Forschung ausgeschlossen werden sollten.
Sein empirisches Verfahren und seine Anwendung mathematischer Naturbeschreibung wurden zu den beherrschenden Kennzeichen der Wissenschaft im 17. Jahrhundert und bilden bis zum heutigen Tag wichtige Kriterien für wissenschaftliches Vorgehen.
René Descartes (1596 -1650):
René Descartes, französischer Mathematiker und Philosoph, postulierte die grundlegende Trennung zwischen Körper und Geist (Dualismus). Er unterschied zwei nicht aufeinander rückführbare Grundformen der Wirklichkeit: die Bewusstseinswelt und die mechanistisch erklärbare Welt. Die materielle Umwelt funktionierte nach Descartes wie eine Maschine. Dieses Bild von der Maschine bezog er auch auf lebende Organismen: Für ihn waren Pflanzen und Tiere Maschinen, wenn auch recht. komplizierte. So sah er auch den Körper des Menschen als eine Maschine an, die allerdings eine rationale Seele besaß.
Descartes gilt als Begründer der modernen Philosophie. Er suchte nach der absoluten Gewissheit und wollte eine vollständige Wissenschaft der Natur konstruieren. Seine Aufgabe sah er darin, alle Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. „Alle Wissenschaft ist sicheres, evidentes Wissen. Wir lehnen alles Wissen ab, das nur wahrscheinlich ist, und meinen, dass nur die Dinge geglaubt werden sollten, die vollständig bekannt sind und über die es keinen Zweifel mehr geben kann.“(Weischedel, S.114 ff) Dieses Denken bildete die Grundlage seiner Philosophie. Die kartesianische Gewissheit ist im wesentlichen eine mathematische. Alles hat eine mathematische Struktur. Die Eigenschaft alles Gegenstände ist berechenbar. Er schreibt deshalb: „Ich lasse keine von ihnen als wahr gelten, die nicht mit der Klarheit mathematische Beweisführung aus allgemeinen Vorstellungen abgeleitet ist, deren Wahrheit nicht angezweifelt werden kann. Da alle Naturerscheinungen auf diese Weise erklärt werden könnten, bis ich der Ansicht, dass keine sonstigen Grundsätze der Physik ausgelassen werden müssen oder auch nur wünschenswert sind.“(Weischedel, S. 114 ff) Damit sein Plan durchgeführt werden konnte schuf er eine neue Methode des Denkens die als Einführung in die Naturwissenschaft dienen sollte. Dies verrät auch sein Werk mit dem Titel: „Abhandlungen über die Methode, den eigenen Verstand richtig zu leiten und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen.“(Weischedel, S. 114 ff) Das wichtigste Element seiner Methode war der Zweifel. Er zweifelt grundsätzlich an allem so lange, bis er bei etwas angelangte das er nicht mehr bezweifeln konnte, nämlich der Existenz seiner selbst.
„Ich denke, also bin ich“, ist seine bekannteste Aussage. Er sucht damit den Ursprung aller Gewissheit nicht mehr in Gott, sondern im Menschen. Er wollte seine Philosophie auf ein berechenbares Fundament stellen, wenn er sagt: „alles von Grund auf umzustürzen und von den ersten Fundamenten aus neu zu beginnen.“ (Weischedel, S.119) Das absolut Wahre drückte sich für ihn etwa darin aus, dass zwei und drei fünf ist. Absolutes Wissen erlangte man seiner Meinung nach durch Intuition und Deduktion. Seine Methode war eine analytische. Gedanken und Probleme mussten solange analysiert werden, bis sich aus ihnen eine logische Ordnung ableiten ließ. Damit wurde ein wesentlicher Zug modernen wissenschaftlichen Denkens grundgelegt.
Isaac Newton (1643 – 1727):
Isaac Newton, englischer Physiker und Philosoph, vollendete das Gedankengebäude von Descartes und Galilei durch eine präzise mathematische Formulierung des mechanistischen Weltbildes (Gravitationstheorie). Newton erfand eine völlig neue mathematische Methode, um die Bewegung fester Körper zu beschreiben (Differentialgleichung). Die Bedeutung dieser Gesetze lag in der universalen Anwendbarkeit. Das Newtonsche Universum war ein gewaltiges mathematisches System, das nach exakten mathematischen Gesetzen funktionierte. Diese galten innerhalb des gesamten Sonnensystems und schienen die Naturanschauungen von Descartes zu bestätigen. Diese Vorgänge spielten sich im dreidimensionalen Raum der euklidischen Geometrie ab. Newton sagte, dass der absolute Raum seinem Wesen nach so beschaffen sei, daß er ohne Rücksicht auf etwas außerhalb Liegendes immer gleich und unbeweglich bleibt. Alles Bewegliche fand in der von der physikalischen Welt getrennten Dimension der Zeit statt, die wiederum absolut war und keine Verbindung mit der Welt der Materie hatte und gleichförmig von der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft floss. „Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließet von sich aus und gemäß ihrem Wesen gleichförmig und ohne Rücksicht auf irgendwelche äußeren Dinge ,“ wie Newton formuliert. In seinem Buch Mathematische Grundlagen der Naturwissenschaft stellten alle Einzelheiten seiner Welttheorie vor. Newton stellte sich die Welt als eine vollkommene Weltmaschine vor, die ein außerhalb von ihr stehender Gott nach seinen göttlichen Gesetzen erschaffen hatte. „Ich halte es für wahrscheinlich, dass Gott am Anfang die Materie als feste, harte, massive, undurchdringliche, bewegliche Partikeln schuf, in der Größe und Gestalt und mit solchen Eigenschaften und in solchem Verhältnis zum Raum, wie sie dem Zweck am dienlichsten waren, für den er sie erschaffen hatte, und dass diese einfachen Partikeln als Festkörper unvergleichlich härter sind als irgendwelche porösen Körper, die aus ersteren aufgebaut sind; sogar so hart, daß sie nie verschleißen oder zerbrechen. Keine gewöhnliche Kraft vermag zu trennen, was Gott selbst am ersten Schöpfungstag schuf“. So zeigt Newton ein Bild der Welt, die aus kleinsten Teilchen geschaffen wurde. Als Folge daraus konnte man die Welt als mechanisches System verstehen, das objektiv beschrieben werden konnte. Im 18. und 19. Jahrhundert erlangte dieses Denken seinen Höhepunkt. Mit seinen Theorien war man in der Lage, die Bewegung der Planten, des Mondes und der Kometen zu erklären, aber auch den Wechsel der Gezeiten und viele mit der Schwerkraft zusammenhängende Phänomene. Newtons galten als Theorien der wahren Wirklichkeit und führte zu vielen wissenschaftlichen Revolutionen. Die Physik wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts zur Grundlage aller Naturwissenschaften.(vgl. Capra 1998)
Im wesentlichen ist der Reduktionismus die Natursicht eines Uhrmachers. Sie lässt sich aus diesen Teilen wieder zusammensetzen. Der Reduktionismus stellt sich auch die Natur als etwas vor, was sich zusammensetzen und auseinander nehmen läßt. Reduktionisten glauben, dass auch die komplexesten Systeme aus atomaren und subatomaren Entsprechungen, wie Federn, Zahnrädern und Hebeln bestehen, die die Natur auf unendlich vielfältige, geniale Art kombinierte.
In der Chaostheorie wird vom „deterministischen Chaos“ gesprochen. Der Begriff Determinismus bedeutet ursprünglich die Lehre von der Vorbestimmtheit alles Geschehens und kommt aus dem Lateinischen. In der Ethik ist es die der Willensfreiheit widersprechende Lehre von der Bestimmung des Willens durch innere oder äußere Ursachen im Gegensatz zu Indeterminismus. (vgl. Duden, S. 153)
Der physikalische Determinismus entspricht dem kartesianisch-newtonschen Weltbild. Alles was geschieht, hat eine definitive Ursache und eine denfinitive Wirkung. Ein berühmter Vertreter des physikalischen Determinismus ist der französische Mathematischer und Astronom Pierre Simone Laplace (1749-1827). Von ihm stammt folgendes Zitat: „Ein Intellekt, der zu einem gegebenen Zeitpunkt alle in der Natur wirkenden Kräfte kennt und die Lage aller Dinge, aus denen die Welt besteht- angenommen, der erwähnte Intellekt wäre groß genug, diese Daten zu analysieren-, würde in derselben Form die Bewegungen der größten Körper im Universum und die der kleinsten Atome erfassen; ihm wäre nichts ungewiß, und die Zukunft wie die Vergangenheit wären seinen Augen gegenwärtig.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S 212)
Der hier beschriebene „Intellekt“ ist als der „Laplacesche Dämon“ bekannt geworden, der die Welt von außen betrachtet und aufgrund seines absoluten Wissens selbst die Zukunft präzise vorhersagen kann.
Der psychologische Determinismus geht wesentlich auf den englischen Aufklärer David Humes (1711 – 1776) mit seiner Lehre von der ‚konstaten Verknüpfung‘ zurück. Er vertritt dabei die These, daß „gleiche Ursachen stets gleiche Wirkungen haben und daß gleiche Wirkungen stets auf gleiche Ursachen zurückgehen.“ Kriz/Lück/Heidbrink, S. 212
Die Physiker des 19. Jahrhunderts waren noch davon überzeugt, daß das Universum wirklich ein großes mechanisches System sei, das nach den Newtonschen Bewegungsgesetzen funktionierte und dessen Anfangsbedingungen man erfassen kann. Diese Gesetze wurden als endgültig angesehen.
„Die Menschheit sah sich nun selbst als das Ergebnis unwahrscheinlicher Zusammenstöße von Teilchen, die den teilnahmlos herrschenden Gesetzen, des Weltalls gehorchten. Als Kinder der Götter entthront, aber im Besitz um diese Gesetze, setzten die Menschen sich selbst auf den Thron. „(Briggs/Peat, S. 27)
Thomas S. Kuhn hat auf Basis wissenschaftsgeschichtlicher Analysen ein Erklärungsmodell für Wissenschaftsentwicklung vorgelegt. Nach ihm verläuft Wissenschaftsentwicklung nicht “ geradlinig“, sondern es muß von einem „Wissenschaftsfortschritt“ gesprochen werden Nach Kuhn werden Phasen „normaler Wissenschaft“ von Perioden „revolutionärer Wissenschaft“ erschüttert. Es gibt Perioden stetigen Ansammelns von Wissen, das als normale Naturwissenschaft bezeichnet wird. Dann jedoch gibt es wissenschaftliche Revolutionen, in denen die Paradigmen sich wandeln. Ein wissenschaftliches Paradigma ist für Kuhn eine Konstellation von Errungenschaften – Begriffen, Wertvorstellungen, Techniken usw.-, die gemeinsames Gut einer wissenschaftlichen Gemeinschaft sind und von ihr angewendet werden, um legitime Probleme und Lösungen zu definieren. „Das Paradigma, welches in der Phase der normalen Wissenschaft bei der Wissenschaftsgemeinschaft (scientific community) mehr oder weniger selbstverständlich die Basis der Forschung bildete in der revolutionären Phase durch ein neues Paradigma in Frage gestellt und schließlich überwunden.“ (Kriz/LücklHeidbrink, S.168)
Ein solcher Paradigmenwechsel etwa geschah zu Beginn unseres Jahrhunderts. Die Sichtweise der Physik wurde entscheidend in Frage gestellt. „Die Erforschung des atomaren und subatomaren Bereichs in den ersten drei Jahrzehnten unseres Jahrhunderts zwang die Physiker zu einer grundlegenden Änderung ihrer Vorstellungen von der Materie, von Raum und Zeit, von Ursache und Wirkung.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 207)
Zwei Theorien erschütterten das bisherige Weltbild der Physik bis in seine Grundmauern: die Relativitätstheorie und die Quantentheorie, beide gehen auf Albert Einstein zurück.
Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht genauer auf diese beiden Theorien eingegangen werden. Einige wichtige Erkenntnisse sollen jedoch dazu verwendet werden, den Paradigmenwechsel erkennbar zu machen.
Albert Einstein (1879 – 1955):
„Im Sinne der Relativitätstheorie ist der Raum nicht dreidimensional, und die Zeit ist keine selbständige Einheit. Beide hängen eng zusammen und bilden ein vierdimensionales Kontinuum, die ‚Raum-Zeit‘. In der Relativitätstheorie können wir daher nie von Raum sprechen, ohne die Zeit einzubeziehen, und umgekehrt. Darüber hinaus gibt es keinen einheitlichen Zeitstrom wie im Newtonschen Modell.
Verschiedene Beobachter werden Ereignisse verschieden in der Zeit einordnen, wenn sie sich relativ zu den beobachteten Ereignissen mit verschieden Geschwindigkeiten bewegen. In einem solchen Fall können Ereignisse, die ein Beobachter als gleichzeitig sieht, anderen Beobachtern in verschiedenen zeitlichen Folgen erscheinen. Alle Messungen, die Zeit und Raum betreffen, verlieren ihre absolute Bedeutung. In der Relativitätstheorie wird der Newtonsche Begriff vom absoluten Raum als Bühne der physikalischen Erscheinung aufgegeben, ebenso der Begriff von der absoluten Zeit. Raum und Zeit werden zu bloßen Wörtern, die ein bestimmter Beobachter zur Beschreibung der beobachteten Phänomene benutzt“. (Capra, 1986, S. 60)
Die wichtigste Konsequenz der speziellen Relativitätstheorie war die Erkenntnis, dass Masse eine Energieform darstellt. Den Zusammenhang zwischen Masse und Energie hat Einstein in der berühmten Formel E = mc2 dargestellt (c ist die Lichtgeschwindigkeit)
Die Quantentheorie wurde auf der Grundlage von Arbeiten der deutschen Physiker Max Planck (1858 – 1947) und Albert Einstein in den zwanziger Jahren durch eine internationale Gruppe von Physikern in enger Zusammenarbeit entwickelt. Dieser Gruppe gehörten u. a. Niels Bohr (1885-1962), der Franzose Louis-Victor de Broglie (1892-1987), die Österreicher Erwin Schrödinger (1887-1961) und Wolfgang Pauli (1900-1958), der Engländer Paul Dirac (1902-1984) und die Deutschen Max Born (1882-1970, Pascqual Jordan (1902-1980) und Werner Heisenberg (1901-1976) an. (vgl. Krüz/Lückl/ Heidbrink, S. 209)
„Bei der Suche nach den kleinsten, nicht mehr teilbaren Bausteinen der Materie hatte man erkannt, dass selbst die subatomaren Teilchen keine Festkörper im Sinne der klassischen Physik waren. Es stellte sich vielmehr heraus, dass diese subatomaren Teilchen eine merkwürdige doppelte Natur besitzen. Je nachdem, wie man sie betrachtet, können ihre Effekte entweder durch das Korpuskel- oder als Wellenmodell erklärt werden. Gleiches stellte sich beim Licht heraus, das entweder als elektromagnetische Schwingung oder als Teilchen auftreten kann. Diese nur schwer zu verstehende Doppelnatur subatomarer Teilchen wird in der Quantentheorie durch Wahrscheinlichkeitsaussagen erklärt. Materie existiert im subatomaren Bereich an einem bestimmten Ort nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeiten hängen mit mathematischen Größen zusammen, die die Form von Wellen aufweisen. Subatomare Teilchen sind also keine ‚wirklichen‘, dreidimensionalen Wellen, sondern ‚Wahrscheinlichkeitswellen‘, abstrakte
mathematische Größen mit den charakteristischen Eigenschaften von Wellen, die über die Wahrscheinlichkeit Auskunft geben, mit welcher die Teilchen an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten anzutreffen sind.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 211) Es kommt immer auf den Standpunkt des Betrachters an.
Das neue Weltbild der Naturwissenschaften hat vor allem seit Fritjof Capra, große Bedeutung gewonnen. Er spricht von „einem Versagen der heutigen Wissenschaft“:
„Indem wir uns weiter in die achtziger Jahre bewegen, wird uns zunehmend bewußt, daß wir uns in einer tiefgreifenden, weltweiten kulturellen Krise befinden. Es ist eine komplexe, mehrdimensionale Krise, deren Aspekte jeden Bereich unseres Lebens berühren – unser Wohlbefinden und unseren Lebensunterhalt, die Qualität unserer Umwelt und unserer gesellschaftlichen Beziehungen, unserer Wirtschaft, Technik und Politik. Es ist ein auffallendes Zeichen dieser Krise, dass Leute, die als Experten auf verschiedenen Gebieten galten, nicht länger mit den vordringlichen Problemen fertig werden, die in ihren Fachbereichen entstanden sind. Ökonomen sind unfähig, die Inflation zu begreifen, Ärzte sind sich uneinig über die Ursache von Krebs, Psychiater stehen vor dem Rätsel der Schizophrenie, die Polizei ist hilflos angesichts der steigenden Verbrechensrate; die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das dieser Ideenkrise zugrunde liegende Problem ist auf allen Gebieten dasselbe. Die meisten unserer Akademiker, Politiker, Geschäftsleute und gesellschaftlichen Institutionen haben ein zu enges Weltbild, das zur Lösung der hauptsächlichen Probleme unserer Zeit unzulänglich ist. Diese Probleme sind ’systemische‘ Probleme, das heißt sie sind eng miteinander verbunden und stark voneinander abhängig. Sie können nicht verstanden werden mit Hilfe der fragmentarischen Methoden, die charakteristisch sind für unsere akademischen Fachbereiche und Regierungsämter. Solche Methoden lösen keine unserer schwierigen Probleme, sondern schieben sie in dem komplexen Netz gesellschaftlicher und ökologischer Beziehungen eher hin und her. Eine Lösung kann nur gefunden werden, wenn die Struktur des Netzes verändert wird, und dies bedingt radikale Transformation unserer gesellschaftlichen Institutionen, Wertberiffe und Vorstellungen.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S.206)
Capra formuliert fünf Kriterien (Capra/ Rast 1994, S. 12-15), die den Paradigmenwechsel in der Naturwissenschaft beschreiben:
1. Wechsel vom Teil zum Ganzen:
Im Rahmen des alten Paradigmas glaubte man, in jedem komplexen System könne man die Dynamik des Ganzen aus den Eigenschaften der Teile ableiten.
Im neuen Paradigma wird das Verhältnis zwischen den Teilen und dem Ganzen umgekehrt. Die Eigenschaften der Teile können nur in Anbetracht der Dynamik des Ganzen begriffen werden. Im Grunde gibt es überhaupt keine Teile. Was wir als Teil bezeichnen, ist nur ein Muster in einem untrennbaren Gewebe von Zusammenhängen.
2. Wechsel von der Struktur zum Prozeß
Nach dem alten Paradigma glaubte man, es gebe fundamentale Strukturen, und dann Kräfte und Mechanismen, durch die diese interagieren, wodurch ein Prozess in Gang komme.
Im neuen Paradigma gilt jede Struktur als Manifestation eines ihres zugrunde liegenden Prozesses. Das Ganze ist seinem Wesen nach organisch.
3. Wechsel von der objektiven zur „epistemischen“ Naturwissenschaft
Im alten Paradigma glaubte die Naturwissenschaft, objektiv zu sein, d.h. unabhängig vom menschlichen Beobachter und dem Prozess des Erkennens.
Im neuen Paradigma glaubt man, die Epistemiologie (Erkenntnislehre, Lehre vom Wissen) – also das Verstehen des Erkenntnisprozesses -müsse ausdrücklich in die Beschreibung der Naturphänomene einbezogen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Konsens darüber, was die richtige Epistemologie ist. Doch entsteht langsam Konsens darüber, daß Epistemologie ein integraler Bestandteil der Naturwissenschaft sein muss.
4. Wechsel vom Gedankengebäude zum Netzwerk als Metapher des Erkennens
Die Metapher von der Erkenntnis als einem Gedankengebäude- fundamentaler Gesetze, fundamentaler Prinzipien. Grundbausteine usw.- ist in der abendländischen Naturwissenschaft und Philosophie seit Tausenden von Jahren gebräuchlich.
Während eines Paradigmenwechsels hat man den Eindruck, dass die Grundlagen der Erkenntnis zusammenbrechen. Im neuen Paradigma wird diese Metapher durch die des Netzwerks ersetzt. Da wir nun die Wirklichkeit als ein Netzwerk von Zusammenhängen wahrnehmen, bilden auch unsere Beschreibungen ein Netzwerk mit vielfachen Querverbindungen, das die beobachteten Phänomene repräsentiert; in einem solchen Netzwerk gibt es weder Hierarchien noch Fundamente. Die Vorstellung, die Physik biete das maßgebende Modell für alle anderen Wissenschaften und liefere die Vorstellungsbilder für wissenschaftliche Beschreibung, wird aufgegeben.
5. Wechsel von der Wahrheit zur annähernden Beschreibung
Das kartesianische Paradigma beruht auf dem Glauben an die Gewißheit wissenschaftlicher Erkenntnis.
Im neuen Paradigma wird anerkannt, dass alle wissenschaftlichen Begriffe und Theorien begrenzt und nur Annäherungen sind. Die Naturwissenschaft kann niemals ein vollständiges und definitives Verständnis der Wirklichkeit vermitteln. Naturwissenschaftler befassen sich nicht mit der Wahrheit (im Sinne einer präzisen Entsprechung zwischen der Beschreibung und dem beschriebenen Phänomen); sie befassen sich mit begrenzten und annähernden Beschreibungen der Wirklichkeit. (Capra/Rast 1994, S. 12 -15)
Dennis Gabor entdeckte 1947 das mathematische Prinzip der Holographie. „Ein Hologramm ist eine besondere Art von optischem Speichersystem, bei dem die Abbildung nicht direkt einem Teil der holographischen Aufnahmen zugeordnet werden kann. Entfernt man von der photographischen Platte mit der holographischen Aufnahme einen Teil, so bleibt in der holographischen Projektion das ganze Bild erhalten. Mehr noch: Jeder einzelne Teil des Hologramms enthält das ganze Bild in ‚verdichter‘ Form“.(Kriz/Lück/Heidbrink, S. 214)
„Das Hologramm wird hier zur Metapher für ein neues Weltbild, bei dem das Universum selbst ein gigantisches Hologramm zu sein scheint, bei dem jeder Teil im ganzen und das Ganze in jedem seiner Teile ist.“ (Wilbert, 1986, S. 9 zit. bei Kriz/Lück/Heidbrink, S. 214) „So wird auch das menschliche Gehirn als Hologramm verstanden, das ein holographisches Universum interpretiert.“ (Ferguson, 1986, S. 21 zit. bei Kriz/Lück/Heidbrink, S. 214)
Von David Bohm wird das Konzept der „eingefalteten Ordnung“ entwickelt, für das das Hologramm ein Beispiel ist. Als Beispiel für diese eingefaltete Ordnung beschreibt Bohm ein Gerät, „das im wesentlichen aus zwei konzentrischen Glaszylindern besteht, zwischen denen sich eine zähflüssige, durchsichtige Flüssigkeit, wie zum Beispiel Glyzerin, befindet. Läßt man nun einen Tropfen unlöslicher Tinte in die Flüssigkeit fallen und dreht den Zylinder langsam, dann wird der Tropfen zu einem dünnen, langen Faden. Dreht man den Zylinder vorsichtig wieder rückwärts, wird der Faden wieder zu einem Tropfen. Der zu einem Faden ausgezogene Tropfen wird von Bohm als ‚eingefalteter Tropfen‘ angesehen. An der Wiederherstellung des Tropfens ist die gesamte Flüssigkeit beteiligt.“ (Kriz./Lück/Heidbrink, S. 215)
Er will damit verdeutlichen, dass „eine innere Ordnung in den kleinsten Elementen besteht, von denen für unsere Wahrnehmung jeweils nur ein bestimmter Aspekt manifest wird. Diese Ordnung transzentiert nicht die Elemente, sondern unterschreitet sie.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S.215) Bohm sieht in der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik wichtige Belege dafür, daß man die Welt nicht in separate und voneinander unabhängige Teile zerlegen kann.
Er geht sogar noch weiter und stellt eine Verbindung zwischen meist östlicher Mystik und Naturwissenschaft her. Diese liegt „vermutlich zum Teil darin begründet, daß dieser Naturwissenschaftler sich mehr als andere über die Unbeweisbarkeit vieler naturwissenschaftlicher Grundannahmen im klaren“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 215) ist:
„Physik läßt sich in absolutem Sinne überhaupt nicht beweisen, weil sie auf allerlei Annahmen beruht, von denen viele sogar noch unbekannt sind … Einige davon mögen falsch, andere richtig sein. Da es also keine Möglichkeit gibt, Physik zu beweisen, und genauso sicher keine Möglichkeit Mystik zu beweisen, halte ich jeden Versuch für einen Fehler, irgend etwas mit absoluter Sicherheit beweisen zu wollen. Dennoch könnte sich aus dem Dialog zwischen beiden etwas Wertvolles ergeben, in dem Sinne, daß jeder vom anderen lernen kann. Zugleich mag jeder entdecken, daß einige seiner Voraussetzungen unsinnig sind und besser aufgegeben werden sollten. Das könnte dann beiden erlauben, Wege zu etwas Neuem zu finden, die sie nicht unwiderruflich trennen.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 215)
Verschiedene Ansichten:
Wo Chaos beginnt, hört die klassische Wissenschaft auf. Solange die Wissenschaft Physiker besaß, die nach Naturgesetzen forschten, blieb sie mit einer besonderen Form von Unwissenheit behaftet: über die Unordnung in der Atmosphäre, im stürmischen Meer, in den Fluktuationen wildlebender Tierpopulationen, in den Oszillationen von Herz und Gehirn. Die unregelmäßige Seite der Natur also, ihre diskontinuierliche und errastische Dimension, hatte für traditionelles Wissenschaftsverständnis die Bedeutung eines Vexierspiels oder, schlimmer noch, einer monströsen Absurdität.
„Chaosforschung hat mittlerweile zu neuen, speziellen Techniken im Gebrauch von Computern geführt, zu neuartigen Formen graphischer Darstellung, zu Bildern phantastischer und fragiler Formen, denen eine tiefere Komplexität zugrunde liegt.“ (Gleick, S. 13)
Für manchen Physiker bedeutet Chaos inzwischen eher eine Wissenschaft von Prozessen statt von Zuständen. „Chaos durchbricht die Grenzlinien, die bisher, die einzelnen Wissenschaftsgattungen voneinander schieden. Als eine Wissenschaft, die von der umfassenden Natur der Systeme handelt, führt es Gelehrte der verschiedensten Bereiche zusammen, die bislang völlig getrennt von einander gearbeitet hatten.“ (Gleick. S.14)
Die Tendenz zur Spezialisierung erfuhr durch die Entdeckungen der Chaosforschung eine nahezu dramatische Umkehr.
„Chaos förderte neuartige Probleme zutage, die nicht immer widerspruchsfrei aufgehen, scheinbar oft sogar den traditionellen Formen und Wegen wissenschaftlichen Denkens zuwiderlaufen. Es ermöglicht kühne Thesen über das Verhalten komplexer Strukturen. Die ersten Chaostheoretiker besaßen einen Blick für Muster und Strukturen, vor allem für solche, die simultan auf verschiedenen Ebenen erscheinen. Sie hatten ein Gespür für Zufälligkeiten und komplexe Gebilde, für ausgezackte Ecken und abrupte Sprünge.“ (Gleick, S. 14)
Wie die neuen Errungenschaften Relativitätstheorie und Quantentheorie, so wird auch die Chaosforschung eine weitere Herausforderung an die Grundlagen der Newtonschen Physik. „Die Relativitätstheorie beendete die Newtonsche Illusion von Zeit und Raum als absolute Kategorie; die Quantenmechanik setzte dem Newtonschen Traum von einem exakt kontrollierbaren Meßprozeß ein Ende; und nun erledigt die Chaostheorie Laplaces Utopie deterministischer Voraussagbarkeit,“ meint ein Physiker. Von allen diesen drei Revolutionen aber bezieht sich Chaos auf das Universum als fühlbares und sichtbares Objekt unserer sinnlichen Wahrnehmung und auf Gegenstände auf der Ebene des Humanen selbst. Tägliche Erfahrungen und reale Anschauungen der Welt wurden so zu legitimen Themen wissenschaftlicher Erkenntnis. Im Bereich der physikalischen Wissenschaft selbst läßt sich die Chaostheorie umschreiben als das Resultat einer Trendwende. Während des größten Teils des zwanzigsten Jahrhunderts bewegte sich ihr Hauptstrom in die Richtung der Teilchenphysik. Die Teilchenphysik brachte Theorien über die grundlegenden Kräfte in der Natur und über den Ursprung des Universums hervor. (vgl. Gleick, S. 15)
„In der klassischen Physik hatte man von komplexen Systemen eine höchst einfache Vorstellung: danach handelte es sich um Systeme, die komplex zu beschreiben waren – sobald Analyseinstrumente zur Verfügung standen, die das leisten konnten. Die Entdeckung, daß diese Annahme falsch ist, hat entscheidend zum gegenwärtigen Interesse an nichtlinearen komplexen Systemen beigetragen. Solche Systeme mögen zwar an der Oberfläche sehr komplex erscheinen, doch sie werden oft von relativ einfachen Teilprozessen erzeugt. Sehr wichtig für das wachsende Verständnis der nichtlinearen dynamischen Systeme war die Entdeckung der Chaostheorie.“ (Lewin, S.24)
In der Chaostheorie geht es um fachübergreifende, interdisziplinäre Erkenntnisse. In dieser Arbeit versuche ich diesem Anspruch gerecht zu werden. Allerdings ist dies in manchen Bereichen, etwa der Biologie, schwer gerecht zu werden.
Lebende dynamische Systeme zeichnen sich dadurch aus, daß sie gleichzeitig eine Geschlossenheit, als auch eine ständige Durchlässigkeit besitzen. Diese Gleichzeitigkeit benötigen diese Systeme, damit sie sich selber stets erneuern können. Ich finde, daß dies besonders gut bei Fließgewässersystemen sichtbar wird. Fließgewässer sind extrem offene Systeme, jedoch zeigen sie auch eine klare, wenn auch oft verzweigte Struktur. Ihr Artenmaximum findet meist an den Übergängen von Rhithral (obere Flußverläufe, Gebirgsfluß) zu Potamal (Region des Tieflandes) statt, wo Überschneidungen der beiden Großlebensräume und somit die Vertreter beider Lebensgemeinschaften anzutreffen sind. Dieser Bereich ist gleichzusetzen den Phasenübergängen in der Chaostheorie, in denen ein System die meisten Wahlmöglichkeiten hat.
Fließgewässer habe ich aber auch deswegen als Beispiel verwendet, da an ihnen durch die vielen Eingriffe des Menschen oft erschreckende Ergebnisse sichtbar (Überschwemmungen, Grundwasserveränderungen, usw.) werden. Es geht dabei um die Gegenüberstellung einer „linearen“ und einer „nichtlinearen“ Sichtweise, die am Bild der verbauten bzw. unverbauten Flußabschnitte sichtbar wird.
Inhaltsverzeichnis
„Chaos“ heißt eigentlich ungeformte Urmasse der Welt, Urwirrwarr; Durcheinander, totale Verwirrung, Auflösung aller Ordnung und ist griechisch-lateinischen Ursprungs. (Duden, S. 119)
In den antiken Kosmogognien, schon bei den Vorsokratikern, aber auch in der noch älteren Schöpfungsgeschichte der Bibel, ist diese Wüste und Leere der Urgrund allen Werdens, aus dem schließlich der Kosmos hervorgehen kann. Chaos und Kosmos, ungeformtes Sein und geordnete Struktur gehören eng zusammen. Diese Deutung von Chaos hat sich bis in die neuere Philosophie erhalten. Die Umgangssprache hat den Begriff Chaos allerdings abgewertet. Sie sieht in ihm nur noch unerwünschten Zerfall von Ordnung (Verkehrschaos, Chaoten, …). Chaos kann auch durch den Zerfall von Ordnung geschehen. In vielen dynamischen Prozessen werden bei Phasenübergängen chaotische Situationen durchschritten, die sich dann zu neuen höheren Ordnungen stabilisieren können. Das ist etwa in allen Verzweigungspunkten, man nennt diese Bifurkationspunkte, von evolvierenden Systemen der Fall. Chaos und Ordnung sind also nicht nur ein Begriffspaar, sie stehen in einem dialektischen oder auch funktionalen Verhältnis zueinander.
Dadurch, daß Henri Poincaré das Weltbild van Newton in Frage stellte, bildete sich plötzlich eine Vielzahl neuartiger Fragestellungen. Wir betrachten vielfach Ordnung und Unordnung als Rivalen im Universum. Einer widerspenstigen Welt wird Ordnung aufgezwungen. Wissenschaftler versuchen mit Hilfe neuer Techniken, vor allem mit dem Computer, das Reich des Chaos zu erkunden. Die unendliche Komplexität der Welt kann nicht nur beschrieben sondern auch sichtbar gemacht werden. Eine neue Geometrie, die fraktale Geometrie, wurde dazu geschaffen. Mit dieser wird Ordnung in der Welt der Unordnung erkennbar.
Die Physiker verstehen unter dem Begriff Chaos das unvorhersagbare Verhalten in Systemen, die deterministischen Gesetzen unterworfen sind. Ein Beispiel ist im Verhalten einer Flipper-Maschine zu sehen: Die Gesetze, die das Verhalten der Maschine bestimmen, sind deterministisch und wohlbekannt: Bewegungen werden von Schwerkraft beeinflußt und es finden elastische Zusammenstöße statt. Trotz dieses Wissens ist es unmöglich die Bahn der Kugel für längere Zeit vorherzusagen. Bisher, glaubte man, daß dies ausschließlich auf praktische Probleme, wie z.B. Meßunsicherheit, zurückzuführen sei. Unvorhersagbarkeit ist jedoch ein grundsätzlicher Charakter, wie Chaostheoretiker verdeutlichen. „Zum ersten Mal wurde das Wort ‚Chaos‘ in dieser Bedeutung 1974 von James York geprägt; der konkrete Anlaß waren Arbeiten des Populationsbiologen Robert May, der herausfand, daß sich gegenseitig beeinflussende Arten, z.B. Luchs und Hase (stellt ein Räuber-Beuteverhältnis dar), in bestimmten Fällen von Jahr zu Jahr auf unvorhersagbare Weise schwindende Zahlen aufwiesen. Seit Beginn der 80er Jahre ist ‚Chaos‘ zu einem Sammelbegriff für eine umfassende Arbeitsrichtung innerhalb nicht-linearer dynamischer Systeme geworden.“ (Raven, S.25f)
Chaotische Systeme weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber den Anfangsbedingungen auf. Die Entwicklung eines Systems kann völlig anders verlaufen sobald die Anfangsbedingungen nur ein klein wenig anders sind als bei einem vorherigen Versuch. Da man die Anfangsbedingungen nie genau kennt, sind solche Systeme über einen bestimmten Zeitraum hinaus im Prinzip unvorhersagbar. Dies liegt nicht nur an der Meßunsicherheit, sondern auch an den inneren Eigenschaften des Systems selber. „Das System ist im Sinne von Berechnung irreduzibel – es gibt keinen kürzeren Weg, Information über das System zu erhalten, als den, es sich selbst entwickeln zu lassen. Die Erforschung solcher Systeme bezeichnet man als ‚deterministisches Chaos‘. Die Entdeckung solcher Systeme hat die wichtige Konsequenz, daß die in der klassischen Mechanik selbstverständliche Gleichsetzung von Vorhersagbarkeit und Determinismus aufgegeben werden muß.“ (Ravel, S. 26) Ein einleuchtendes Beispiel ist das Wetter, wie ich im Kapitel „seltsamer Attraktor“ zeigen werde. Durch seltsame Attraktoren können viele chaotische Systeme beschrieben werden. Ein System kann sich sowohl chaotisch als auch normal verhalten. Chaos ist eine generelle Möglichkeit für alle physikalischen Systeme. Man versucht deshalb die Chaostheorie auf verschiedenen Gebieten anzuwenden. Die Chaostheorie stellt eine mathematisch begründete Universaltheorie dar, die sehr verschiedene Systeme umfaßt. Wissenschaftler versuchen auf Ähnlichkeiten von Mustern bei sehr verschiedenen Phänomenen hinzuweisen. Physiologen entdecken eine überraschende Ordnung in dem Chaos, das im menschlichen Herzen entsteht und zur Hauptursache eines jähen, unerwarteten Todes werden kann. Ökologen erforschen den Aufstieg und Niedergang von Schwammspinnerpopulationen. Ökonomen etwa versuchen sich an einer neuen Art wirtschaftlicher Analyse.
Hauptprobleme dieser Theorie sind etwa die Frage wie das Verhalten von klassisch zu chaotisch wechselt und die Klassifikation verschiedener „seltsamer Attraktoren“.
Da der Begriff Chaos hier nicht im üblichen umgangssprachlichen Sinn zu verstehen ist, sondern verschiedene Systemzustände bezeichnet, denen die typischen Eigenschaften klassischer deterministischer Systeme fehlen, wie die Berechenbarkeit, die Vorhersagbarkeit und die vollständige mathematische Bestimmtheit, ist die Chaostheorie für die praktische Pädagogik von großer Bedeutung. „Vielmehr ist es gerade ein Zustand der Unbestimmtheit, der den Vergleich solcher Systeme mit Erziehungsprozessen so spannend macht und, … auch sachlich angemessen erscheinen läßt“, schreibt R. Huschke-Rhein.“ (von Lüpke/Voß, S.34).
„In der systemtheoretischen Evolutionstheorie gibt es einen speziellen Theoriezweig, der sich mit der Erforschung spontaner Systembildung sowohl auf der Ebene physikalischer Systeme als auch auf der Ebene der biologischen Systeme befaßt. ‚Spontan‘ werden solche Systembildungen genannt, weil sie nicht von externen, außersystemischen Größen veranlaßt werden, sondern bloß intern bedingt sind. Das berühmteste Beispiel sind die spontanen Systembildungen der Materie selber, die von Prigogine (Prigogine, 1979; Prigogine & Stengers, 1981) nachgewiesen wurden. Allerdings stehen solche Prozesse unter einer entscheidenden Bedingung: Ein zu spontaner Systembildung übergehendes chemisches oder physikalisches System muß – aus spontaner oder natürlicher auch gelegentlich aus externer Veranlassung – sich in einem Zustand des internen Ungleichgewichts befinden, einem Zustand, wie Prigogine sagt, ‚fernab des Gleichgewichts‘. Diese Systemzustände werden erreicht nach ‚Symmetriebrüchen‘, wie Jantsch (1980) sagt, sie werden auch als ‚Systeme im dritten Zustand‘ bezeichnet (Laszlo, 1987,S. 36ff.), und zwar nach den Gleichgewichtssystemen (1. Zustand) und den homöostatischen Systemen (2. Zustand), die um einen Gleichgewichtszustand herum schwanken. Jantsch hat vermutet, daß die gesamte Evolution überhaupt nur entstehen konnte durch einen elementaren Symmetriebruch im Anfangs- bzw. Urzustand des materiellen Universums. „(von Lüpke/Voß, S. 34)
Wichtig für Entwicklungstheorien ist dabei, daß Systeme im sogenannten „dritten Zustand“ anderen Entwicklungsgesetzen folgen als bisher angenommen wurden.
Die bisherige Entwicklungspsychologie war vorwiegend an den linearen, berechenbaren, voraussagbaren, kontinuierlichen, meßbaren und erwartungskonformen Verläufen interessiert. Wenn jedoch eine Entwicklung von der von der Gesellschaft definierten „Norm“ abweicht, so gibt es verschiedene Therapiekonzepte die diese Abweichung korrigieren. Den von der Chaostheorie bzw. der allgemeinen dynamischen Systemtheorie her denkenden Modellen liegen neue wissenschaftstheoretische Vorstellungen zugrunde. Systeme werden als indeterminiert, nicht prognostizierbar angesehen. Sie werden nicht von ‚Faktoren‘, sondern von sogenannten ‚Attraktoren‘ beeinflußt. Diese üben längerfristig eine gleichsam ‚magnetische‘ Wirkung auf bestimmte Systembereiche aus, sie sind aber meist nicht im Voraus als solche erkennbar und also auch nicht berechenbar. Diese Systeme folgen eigenen, autonomen, internen Bewegungen und sind nicht von außen steuerbar. Außerdem besitzen sie eine extrem hohe Komplexität.
„Die Entwicklung eines Kindes findet immer auf verschiedenen Ebenen statt, die monokausal nicht miteinander verknüpft sind. “ (von Lüpke/Voß, S.35)
Störungen und Symptome werden nicht als Abweichung von einer vorgegebenen Norm bewertet, sondern als Funktion im Balance-Akt zwischen Sicherheit und Bewegungsfreiheit. „Widersprüche, Krisen, Paradoxien, starke Gleichgewichtsschwankungen – diese zunächst mathematischen Parameter von chaotischen Systemprozessen sind zugleich auch Beschreibungsgrößen für die Entwicklung psychischer Systeme. Kreativität ist gar nicht ohne solche Begriffe beschreibbar, und wir könnten darüber nachsinnen, ob nicht alle Kinder, solange sie psychisch ‚lebendig‘ sind, mit solchen Begriffen beschrieben werden sollten.“ (von Lüpke/Voß, S. 36)
An dieser Stelle möchte ich den Autopoiesisbegriff (Maturana & Varela, 1987) erwähnen (siehe Pkt. 5.4). Er besagt für den Menschen, daß die Operationsweise unseres Gehirns – und das gilt gleichermaßen für kognitive wie für emotionale Prozesse – ’selbstreferentiell‘ ist, daß allein im Rahmen der internen Systembedingungen des jeweiligen Gehirns entschieden wird, welche von außen kommenden Einwirkungen ‚angeschlossen‘ werden und welche nicht. Jedes Gehirn ist auf Grund seiner physiologischen Operationsweise im Prinzip autonom. Entwicklung kann demnach als gesteuert verstanden werden.
Huschke-Rhein stellt in „Entwicklung im Netzwerk“ einige pädagogische Folgerungen auf: (von Lüpke/Voß, S.36 40)
1. Erziehung
Der Pädagoge oder Erzieher bekommt die Rolle des Beobachters zugeschrieben, der jeweils nur geringfügige Steuerimpulse gibt und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem abwartet.
2. Thesen
„Jede pädagogische Entwicklung ist ein Transformationsprozeß, in dem sich eine Person (ein autopoietisches System) in Richtung größerer Selbststeuerung selbstreferentiell transformiert, d.h. selbstbezüglich über seine Anschlüsse entscheidet.“ (S. 36) Alle pädagogischen Handlungen stellen deshalb eine Paradoxie dar. Systeme, die sich tendenziell selbst steuern, wären durch Fremdsteuerung zu steuern.
3. Anschlußfähigkeit (Rezyklität)
„Der Aufbau einer gelingenden Entwicklung beim Kind erfolgt durch eine langsame und emotional fundierte Steigerung der Umweltkomplexität.“ Ausgehend von einer verläßlichen Mutter-Kind-Beziehung bis hin zu einer immer weiter werdenden Welt- und Umwelterfahrung. Allerdings darf das Kind dabei nicht überfordert werden – die Schritte müssen nachvollzogen werden können – sie müssen ‚anschlußfähig‘ sein. Es gibt eine sogenannte Naturbasis von der ausgegangen werden kann: „Jedes Kind bringt eine gewisse Kapazität für die Verarbeitung von personalen, sachlichen, sozialen und emotionalen Umwelterfahrungen mit, und diese Basis müssen wir als natürliche Basis respektieren, auch und gerade bei Behinderungen des Kindes.“
4. Diversität
Diversität bedeutet die Anerkennung des Wertes der Vielfalt in Natur und Menschenwelt. Jedes selbstreferentielle System braucht (scheinbar paradox) die Anerkennung durch ein anderes selbstreferentielles System, obwohl beide in hohem Grad autonom sind. Die Koppelung erfolgt nach Maturana entweder ’strukturell‘ durch soziale Normen oder direkt ‚durch Liebe‘.
5. Transformation
Alle pädagogischen Prozesse, […] sind Transformationsprozesse, in denen ein Selbst (’selbstreferentielles System‘) sich in Richtung auf größere Selbststeuerung (Autonomie) transformiert. […] Das Ziel dieses Transformationsprozesses liegt hier wie in der Pädagogik überhaupt in der zunehmenden Selbstbestimmung und der Loslösung aus den ersten Systembindungen, aber nicht, wie heute vielfach fälschlich angenommen wird, mit dem Ziel vollkommener Autonomie, sondern nur, wie der Systemansatz bescheidener formuliert, mit dem Ziel erneuter Integration in andere Systeme, d.h. also mit dem Ziel weiterer Transformationen. Die letzte Stufe dieses Prozesses ist allerdings die Transformation in den Zustand der Aufhebung der irdischen, d.h. raumzeitlich gebundenen Transformationsprozesse.
Diese Forderungen unterstreichen, daß das Kind nicht mehr als Objekt gilt, das alles aufzunehmen hat was ihm von seinen Lehrern vorgeben wird. Der Lehrer wird zum Partner des Kindes, der ihm Angebote macht, aus denen das Kind auswählen kann. Es wird seine Auswahl so treffen, daß es seiner Entwicklung dienlich ist. Es braucht eine verläßliche Umwelt, in der es Bestätigung erfahren kann. Jedes Kind ist auf seinem Weg zu mehr Selbstbestimmung zu unterstützen. Hermann Hesse drückt dies mit folgenden Worten aus:
„Der Mensch ist nichts Festes, Gewordenes
und Fertiges, nichts Einmaliges und
Eindeutiges, sondern etwas Werdendes, ein Versuch, eine
Ahnung und Zukunft, Wurf
und Sehnsucht der Natur nach
neuen Formen und Möglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
Im Folgenden werde ich die uns gewohnte“lineare Denkweise“, wie sie seit der Zeit von Newton in das Denken der Menschheit Einzug gehalten hat, erklären und der eher ungewohnten „nichtlinearen Denkweise“, wie sie Poncaré schon gesehen hat, am Beispiel des Wandels der Natur zur Kultur aufzeigen.
„Lineare Beziehungen lassen sich durch eine gerade graphische Linie verdeutlichen. Lineare Systeme weisen eine wichtige modulare Eigenschaft auf: Sie lassen sich aufeinander nehmen und wieder zusammensetzen. Die Teile passen stets wieder zusammen. Nichtlineare Systeme hingegen sind in aller Regel nicht auflösbar; sie lassen sich nicht beliebig trennen und zusammensetzen. Bei Fließsystemen und mechanischen Systemen sind die nicht beliebig trennen und zusammensetzen. Bei Fließsystemen und mechanischen sind die nichtlinearen Terme die Merkmale, die im Bemühen um richtiges und einfaches Verständnis meist übergangen werden.“ (Gleick, S. 40)
In der Mathematik erlaubt bei linearen Gleichungen die Untersuchung einer Lösung dem Mathematiker, das Ergebnis auf andere Lösungen zu verallgemeinern. Bei nichtlineare Gleichungen ist dies nicht möglich. Ein einmal erreichtes Ergebnis wird vielleicht nie wieder vorkommen.
Im Wandel einer Naturlandschaft zu einer Kulturlandschaft wird die lineare Denkweise deutlich sichtbar. Der Naturbegriff fand seine größte Umwandlung vom Übergang des Mittelalters in die Neuzeit: Ein ganzheitliches Welt- und Naturbild, das einer übermenschlichen Kraft und Ordnungsgestalt ungeordnet war. Diesem Denken wurde ein Weltbild entgegengesetzt, dessen Prägung durch das Aufkommen der neuen Wissenschaften verursacht wurde. Ein ganzheitlicher Begriff wurde durch einen komponentiellen ersetzt und somit die Voraussetzung zu einer funktionalistischen Arbeitsweise geschaffen. Mit der Trennung Natur – Kultur wurde dem ganzheitlichen Eingebundensein des Mensch in den Kreislauf der Natur ein Ende gesetzt. Eine vernetzte Ganzheit, in die der Mensch als ein Teil eingewoben ist, wurde objektiert, gewissermaßen verdinglicht, Natur wurde zu einem „Außen“, das es zu beherschen und zu bearbeiten gilt, eben zu kultivieren. Eine Fortsetzung findet diese Spaltung bis heute. Wie radikal dieser Wandel geschehen ist, soll anhand der Flußregulierungen in Europa gezeigt werden. Im Weiteren jedoch auch durch das Aufzeigen der Folgen und Auswirkungen in der Agrotechnik und nicht zuletzt in der Gentechnik.
Am Beispiel der Flußsysteme in Europa wird augenscheinlich, was „Linearität“ in Form von Flußregulierung bedeutet. Flüsse mit einem ausgeweiteten Verlauf; mit breiten Übergängen vom Wasser zu Land, mit für viele Tiere lebenswichtigen Überschwemmungsgebieten wurden begradigt und einbetoniert. Die Folgen für verschiedene Tierpopulationen sind schon relativ lange bekannt. Die Folgen für die Menschen werden leider oft erst durch Katastrophen klar. Überschwemmungen, wie diese z. B. im Sommer 1997 sowohl in Frankfurt a. Oder ebenso wie in Debant im Osttirol geschehen sind, erschrecken uns. Durch die Medien wird klar angesprochen, daß die Ursache u. a. in den Flußregulierungen von einst zu suchen sind, oder darin, daß zu nahe an Flüssen Siedlungen gebaut werden. Fließgeschwindigkeit sei hier nur als eine Komponente genannt, die sich durch die Linierung drastisch verändert hat.
Ich erachte es für interessant, den Wandel der Natur zu einer Kultur aufzuzeigen, da er zum Wandel des Menschenbildes und letzten Endes unseres gesamten Gesellschaftssystems beigetragen hat. In manchen wissenschaftlichen Richtungen scheint in oft erschreckender Weise das „lineare“, einseitige und abgegrenzte Denken weiterhin auf dem Vormarsch zu sein. Durch die neuen Techniken der Humanbiologie sind wir auf dem Weg ein neues Welt- und Menschenbild zu entwickeln. Der Mensch hat sich selbst auf den Thron der Götter gesetzt. Durch die Möglichkeiten in der Gentechnik wird der Mensch zu seinem eigenen Produzenten. Heißt es im Schöpfungsbericht der Bibel: „Und Gott sah, daß es gut war“, so ist dies dahingehend überholt, daß jetzt am Ende des Schöpfungsverses stehen müßte: und der Mensch sah, daß es wurde. Der Mensch ist zum formbaren Objekt des Menschen geworden, so drückte es R. G. Seed Wissenschaftler in einer Fernsehdiskussion aus. (9.7.98 im ARTE)
Der Mensch ist zu seinem eigenen Objekt geworden, das er gestalten kann. Wie ein Konstrukteur kann er bestimmen, wie er sich haben will. Es ist nur eine Frage des Preises. In einem Bericht der Tiroler Tageszeitung vom 18. April 1997 heißt es: „Ein Klon für kinderlose Paare. TOKIO. (dpa, TT) „Der Franzose Claude Verhilhon Rael hat in Tokio die Gründung einer Firma für das Klonen von Menschen bekannt gegeben.“ Das Herstellen des Menschen im Labor ist ein neuer Wirtschaftszweig geworden. Es entsteht ein Markt bei dem es um Angebot und Nachfrage geht. Es wird eine Frage des Preises ob und wieviel es von jedem Exemplar Mensch geben wird. Der Markt bestimmt unsere ethischen Entscheidungen. Diese Aussagen mögen uns erschrecken, doch sind sie in greifbare Nähe gerückt.
Die Frage bleibt offen, wer die ethischen Normen bestimmt, und was in der Folge mit jenen geschieht, die nicht in diese Nonnen hineinfallen. Gerade wenn es um behinderte Menschen geht oder um Menschengruppen, die den Anforderungen der Gesellschaft auf irgend eine Art und Weise nicht gerecht werden können.
In verschiedenen Publikationen wird betont, daß in Deutschland kaum mehr behinderte er zur Welt kommen, da durch die Möglichkeit der Pränataldiagnostik Behinderungen Kinder frühzeitig erkannt werden. Eltern können dadurch besser aufgeklärt werden. Eltern haben die Möglichkeit, sich für oder gegen ein Kind zu entscheiden. Behinderte Kinder können bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden, wenn die Eltern bzw. die Mütter beweisen können, daß sie körperlich bzw. seelisch nicht dazu in der Lage sind, ihr behindertes Kind zu erziehen.
Nicht die Techniken an und für sich sind das, was entsetzt. Bei ihrem Einsatz für verschiedene Therapieformen, wie etwa in der Krebstherapie, werden von vielen Erfolgen berichtet. Jedoch ist es immer die Frage, was mit diesem neuen Wissen geschieht und wer dieses Wissen wie verwendet. Denn eines muß klar sein: was gem acht werden kann, muß auch gemacht werden, denn es lassen sich immer Argumente finden.
Die Menschheit stellte sich die Naturbeherrschung zur Aufgabe. Bereits in den frühesten menschlichen Gemeinschaften wurde durch Magie versucht, den Gang der Natur zu beherrschen. Unkontrollierbare Naturvorgänge sollten beherrscht oder zumindest beeinflusst werden können. Griff der Mensch zuerst nur eher passiv in das Naturgeschehen ein, so gelang es ihm immer mehr, aktiv einzugreifen, vor allem durch die verschiedenen technischen Errungenschaften. Mit der Aufhebung der ganzheitlichen, mythischen Naturauffassung distanziert sich der Mensch in seinen Denkprozessen von der Natur und macht sie sich zum Objekt, das er bearbeitet, kontrolliert, beherrscht. Die Natur wird immer berechenbarer. Was berechenbar ist, kann kontrolliert werden. Was rational als machbar erkannt wird, muss auch durchgeführt werden. Wer nicht freiwillig mitmacht, muss gezwungen werden, wie wir sehen werden. Durch die Trennung von Geist und Materie wird ein Objektiviierungsprozess in Gang geschalten, der es erlaubt, Natur zu beobachten, zu bearbeiten und zu beherrschen.
Eine der markantesten Abwandlungen des Naturbegriffs war mit dem Übergang von der mittelalterlichen zur neuzeitlichen Philosophie verbunden. Einem ganzheitlichen Welt- und Naturbild wurde ein Weltbild entgegengesetzt, dessen Prägung durch das Aufkommen der exakten Wissenschaften bedingt war. Es kam zu einer Umdeutung des Wortes ‚Natur‘ in einer sehr grundlegenden Weise. So wurde zum Beispiel der Natur- und Landschaftsbegriffs, etwa durch das Wort ‚Ökosystem‘ ersetzt.
Die Gedanken des „Fortschritts“ sind zu sehen in der praktischen Umgestaltung der Naturlandschaften in eine Kulturlandschaften. In Deutschland begann der ökonomische Modernisierungsprozeß bereits vor der Industrialisierung. Was man als Agrarreform zu bezeichnen pflegte, war zugleich ökologische Reform und landschaftsverändernde Maßnahme. Das Land, aber auch die Leute mußten ihrer „Wildheit“ entrissen werden.
So verfaßte der Staatsrat Joseph Hazzi, um 1800 eine Beschreibung des „Herzogthums Bayern“ folgendermaßen:
„Das aufgeschwemmte, in Gries und Thon bestehende Terrain enthält nebst der Windach mehrer Bäche, Filz und Moos und einiges Gehügel. Die Wege sind nicht zu passieren. Das Ganze hat ein wildes Aussehen. Die meistens großen, von Holz erbauten Dörfer sind von Waldungen umrungen, und die Kirchen ragen wie aus Holzstössen hervor. Die Landwirtschaft ist hier schlecht bestellt und nimmt höchstens den dritten Theil ein, das übrige ist Wald, Weide oder Filz. Die Felder sind wenig besorgt; die Brache ist auch noch beibehalten. Die wenigen Wiesen sehen eben so unkultiviert aus.“ (Kobold, S. 28) Wälder, Moore und Filze, Dörfer wie Holzstöße, unpassierbare Wege, das sind bei Hazzi keineswegs Chiffren einer positiven besetzten Landschafts- und Naturerlebens, sondern irritierende Zeichen der Wildnis, der Unkultur.
Was die Bauern in den Augen der Reformer alles falsch machten, sieht man in folgender Aussage: „Man sehe nur was immer für Gemeindegründe, Wyeden, Auen, etc. an, wie sie der lieben Natur so vollkommen überlassen werden, als wenn sie der Menschen Hände nicht bedürftig oder würdig wären. Disteln, Dörner, allerhand Unkraut, und Maulwurfshäufungen vermehren sich jährlich darauf; das gute Gras hingegen nimmt ab“, so heißt es in einer Tiroler Schrift von 1767. (Kobold, S. 34)
„Hutung, Trift und Brache, die größten Gebrechen und die Pest der Landwirtschaft“, lautet dann auch der Titel einer aufklärerischen Schrift des Geheimrates Schubart von Kleefeld 1783. (Kobold, S. 35) Auf diese Art und Weise wurde über natürlich gewachsene Landschaften gesprochen.
Dort, wo der Mensch seine durch viel Erfahrung erprobtes Leben nicht einfach aufgeben wollte, wurde zu härteren Mitteln gegriffen. Kultivierung oder Enteignung war die Devise der Reformbewegung unter Maria Theresia. 1769 verfügte sie deshalb: „jeder muss in den nächstfolgenden zwey Jahren durch gehörige Pflege nach Maaß seines Feldwirtschaft-Standes …,sonderlich feuchte Orte, in Wiesen oder aber durch Umrisse und Anbau …in Klee- und Grasfelder stückweise verwandeln; im überigen die Widerspenstigen und Nachläßigen ihres Antheils verlustig seyn“ . (Kobold S.36)
Mit gewaltsamen Methoden wurden die Bauern gezwungen, ihr Land zu kultivieren. „Boden“, „Erde“, „Länderey“ sind ein mehr oder weniger einheitliches und gefügiges Substrat, – „gehorsame Erde“. Die Landschaft, die man vorfand, war durchaus nicht natürlich, sondern eine solche Landschaft galt es erst herzustellen nach einem Plan, der auf menschlichem Denken, auf der Erkenntnis „wahrer“ Naturgesetze und einer „wahrhaft“ „naturgewollten“ Ordnung basiert. Die Vielfältigkeit, das Miteinander in der Natur durfte nicht mehr sein und galt als Verstoß gegen die Ordnung: „Der Fehler liegt in der leidigen Unordnung, nach der man keine Sache in seiner Art allein, zufolge der weisen Vorschrift der Natur, recht nutzen will“! (Kobold S. 39)
„Eigensinn, Aberglaube, Müßiggang und Unverstand sind bisher die stärksten Hindernisse vernachlässigt und nicht so der Nutzen davon recht heraus gesucht worden ist.“ (Churbayer, Intelligenzblatt; 1767 zit. in Kobold, S. 40).
Das ausgeklügelte Lebens- und Überlebenssystem der Bauern von damals wurde in Frage gestellt. Denn diese hatten gelernt, in vielfältiger Weise trotz der klimatisch schweren Bedingungen, ihr Land sinnvoll für ihr Überleben zu nutzen. Vielfalt und Komplexität zeichneten die traditionelle ländliche Wirtschaft aus. Fast alles stammte aus dem eigenen Dorf oder aus eigenen Erzeugnissen.
Was man damals abzuschaffen begann, war eine Wirtschaftsweise, die mit fließenden Übergängen und einer bisweilen noch recht „wildwüchsigen“ Natur zu leben verstanden; die nicht auf Spezialisierung, sondern eher auf Vielfalt und integrierte Produktionsabläufe baute; war eine Wirtschaft die kaum Wachstum, aber halbwegs stetige Erträge im Rahmen erlaubte. Die Bauern pflegten damals durch ihre Vielfalt „Schadensbegrenzung“ nicht „Gewinnmaximierung“.
Im Zuge der Modernisierung sind Prinzipien über Bord geworfen worden und Kompetenzen sind verkümmert, die man heute – unter veränderten Bedingungen gebrauchen könnte. Heute wissen wir: „Wird die natürliche Strukturvielfalt durch den Menschen herabgesetzt, resultiert daraus Reduktion der Artenzahl und Diverisität, aber auch der Dichte, Biomasse und Produktion. “ (Studie 1998, S. 87)
Die Natur:
Mit dem Beginnen der Industrialisierung änderten sich die Ansprüche an die Erträge der Landwirtschaft. Früher war die Tätigkeit der Bauern nicht absatz- und gewinnorientiert, sie diente überwiegend dem eigenen Überleben. Mit der Zeit wurde es jedoch notwendig, daß die Menschen die in der Industrie arbeiteten und in den Städten lebten, von den Produkten der Bauern ernährt werden mußten.
„Um Europa seinen Aufschwung, sein Bevölkerungswachstum, die Verstädterung und Industrialisierung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu erlauben, bedurfte es eines gewaltigen Anstiegs der agrarischen Produktion. Und die erste Maßnahme, die man ergriff, war die Ausdehnung der Kultivation: die großflächige Umgestaltung und Indienstnahme der ‚Landschaft‘ für die Zwecke einer effizienten Agrikultur. Das Erzeugungsvolumen war zum entscheidenden Effizientskriterium geworden. „Es galt, die Böden möglichst ertragreich zu nutzen. „Man schritt zu Nutzungsformen, die die Landwirtschaft und Agrarlandschaft – verstärkt nochmals die Industrialisierung – mehr und mehr aus natürlichen Kreisläufen auskoppelten durch und die mittlerweile längst negative Auswirkungen auf das Ökosystem und – unter gewandelten ästhetischen Vorzeichen – auch das Landschaftsbild zeigen“(Kobold, S. 43 ff.)
Im Sinne des größeren Nutzens, im Sinne einer größeren Wirtschaftlichkeit gilt es bis heute Landschaft, Pflanzen Tiere und nicht zuletzt den Menschen zu beherrschen und zu manipulieren. So etwa zeigt Furrer anhand eines Beispieles aus der Agrotechnik gut auf, wie Pflanzen genetisch verändert, d.h. gezüchtet werden, die gegen bestimmte Schädlingsbekämpfungsmittel resistent sind. Diese Pflanzen können aber nur noch mit Hilfe bestimmter Dünger, natürlich von derselben Firma hergestellt, wachsen. Daraus ist klar zu ersehen, wie es einem Saatgutkonzern gelingt, das Land und seine Bauern zu beherrschen.
Im Falle der Nutztiere ist ähnliches bekannt. Berichte von Superkühen und fettarmen Riesenschweinen sind den Medien zu entnehmen. Der Agrotechnik gelangen wichtige Schritte auf dem Weg zum einheitlichen, linearen Modellebewesen. Wäre nicht ein Arbeiter, der resistent gegen die Gifte und Abfallprodukte dieser Industrie, ist ein willkommenes Geschöpf? Ich hoffe, dass diese markaber anmutende Bemerkung markaber bleibt.
Artenvielfalt, wie sie früher zum Überleben der Bauern und der gesamten Bevölkerung notwendig war, ist nicht mehr gefragt. Leistungssteigerung, Absatzerhöhung, Ertragssteigerung und Globalisierung sind Schlagworte, denen eine Vielfalt weichen muß. Der Weltmarkt bestimmt den Preis und die Art. Die Welt ist zusammengewachsen. Das dahinterstehende Absatzsystem ist so ausgeklügelt, daß auch der Bauer im hintersten Seitental des Tiroler Lechtales nicht mehr ohne das von den Landwirtschaftverbänden genehmigte Saatgut, ohne die von der EU genehmigten Samen bestimmter Stiere existieren kann. Der Bauer wird dabei zwar nicht mehr direkt seines Landes enteignet, wie zur Zeit von Maria Theresia, aber er bekommt dafür keine Subventionen vom Land, Staat oder der EU. Ohne diese Gelder kann er jedoch nicht mehr existieren und überleben, da die Preise für seine Absatzprodukte ebenfalls vom Markt bestimmt werden. Diese werden möglichst niedrig gehalten.
Wie ich finde drückt es R. Beck treffend aus, wenn er schreibt: „Die ökologische Verfassung und das Aussehen unserer Landschaft hängen entscheidend davon ab, was die Wirtschaftszweige, die sich ihrer bedienen, aus ihr machen.“ (Geck in Kobold, S.28)
Der Mensch:
Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts sich die Einstellung nicht nur gegenüber dem Menschen. In diesem Zeitraum wurden behinderte Menschen zu einem besonders wahrgenommen Personenkreis. Davor galten sie galten selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. Im Folgenden beziehe ich mich auf I Von der Schmitten, der diesem Prozeß der Wahrnehmungsänderung von Behinderungen in Salzburg anschaulich beschreibt. Ärzte begannen es als ihre Aufgabe zu sehen „dem Übel“ auf den Grund zu gehen und die dazu nötigen Tatsachen genau zu beobachten und zu beschreiben. Sie erklärten Schwachisinnige als „einheimische Übel“ und stellten ihre Arbeit in den Dienst des Staates: So beschreiben etwa die Brüder Wenzel: “ daß die Blüte eines Staates nach der Menge der betriebsamen und thätigen Bürger zu berechenen sey. Desto größer in der Pflicht der Ärzte, auf Ausrottung aller jener Uebel zu denken die dem großen Interesse desjenigen Staates, dessen Mitglieder sie sind entgegenwirken. “ (von der Schmitten, S. 11)
Es entstanden Ansichten, die sich einer neuen Wissenschaftlichkeit verpflichtet sahen, wie sie die Aufklärung hervorgebracht hatte. Betont wurde die Empirie, das Experiment, die Analyse, der Schluß vom Besonderen auf das Allgemeine; bekämpft wurden die jahrhundertlangen a-priori-Wahrheiten der traditionellen und Autoritäten und die Methode der Abteilung der Besonderen aus dem Allgemeinen. Es galt „schlechtes Erbgut“ nicht weiterzugeben: „Das Gesetz sollte vollkommenen Cretinen die Ehe untersagen „(von der Schmitten, S. 14)
Die Natur „draußen“ in der Welt mußte erforscht werden, ebenso wie die „menschliche“ Natur. Im Frankreich des ausgehenden 18. Jahrhunderts etwa organisierten Philosophen und Morallehrer, Metaphsyiker und Ärzte, Historiker und Reisende, Sprachlehrer und Pädagogen in der „Societe des Observateurs de l`Homme“ (Vereinigung der Menschenbeobachter) um eine objektive Wissenschaft vom Menschen zu begründen. Eine Reise haben sie allemal vor, eine geistige Reise in das physische, moralische und intellektuelle Dasein des Menschen. Viele gehen daher tatsächlich auf Reisen, wobei sie auf den Spuren der ehemaligen kolonialen Eroberer wandeln, mit dem Ziel, die „Wilden“ an der „Wiege der menschlichen Gesellschaft“ zu beobachten und so Rückschlüsse auf die Natur der Zivilisierten, sprich europäischen Völker ziehen zu können. Gleichzeitig sollten die Errungenschaften der europäischen Zivilisation den Wilden beibringen. Die innere Kolonialisierung der einst eroberten Territorien wird zum Programm erhoben, deren direkte physische Besetzung ist nicht mehr aktuell.
Erobert wird jetzt der „menschliche Körper“ auf der anatomischen Landkarte. (vgl. von der Schmitten, S. 11, ff.)
Naturbeherrschung wird langsam zu Menschenbeherrschung. Der menschliche Körper wird immer mehr zum Forschungsobjekt wie etwa der Medizin und der Arbeitstechnik, aber ebenso der Psychologie und Pädagogik. Dieses Denken treibt seine Blüten in immer vollkommener Art und Weise bis in unsere Tage. Immer genauer werden Menschen in Kategorien eingeteilt und zugeordnet. In einem Gesellschaftssystem in dem Normierung ein Grundprinzip ist, gilt es andere Sichtweisen aufzuzeigen und auch wissenschaftlich dazurstellen.
Durch die Normwertorientierung in unserer Gesellschaft testen und überprüfen wir Menschen nach ihren Fehlern. Wir stellen fest, daß sie entweder nicht sprechen, nicht lesen oder sich nur begrenzt bewegen können. Das hat zur Folge, daß der betreffende Mensch durch ein Gutachten als z.B. geistig behindert eingestuft wird. Georg Feuser schreibt dazu in einem Aufsatz bei Merz/Frei (S. 104f):
„Wir sagen damit aus, dass er so ist, wie (oder: weil) er uns (so) erscheint. In unserem Gutachten dürfte allenfalls stehen: ‚Unter Anwendung… dieser und jener . Beobachtungs-, Test- und Überprüfungsverfahren stelle ich an Herbert Verhaltensweisen und – bezogen auf bestimmte die es, entsprechend unseren heutigen Standards, bezogen auf die Testparameter und Überprüfungskriterien erforderlich erscheinen lassen, Herbert der Gruppe von Menschen zuzuordnen, einmal im die als geistigbehindert bezeichnet werden.‘ Ob dieser Mensch ‚Herbert‘ – klassischen Raster gedacht, das im Grunde keine Berechtigung hat – ‚geistigbehindert ist oder nicht‘, weiß niemand von uns und ist nicht belegbar. Wir wissen heute nicht einmal entfernt objektiv, was ‚Geist‘ ist, geschweige denn, was eine Behinderung des ‚Geistes‘ oder am ‚Geist‘ sein könnte. Ich denke, es wird hinreichend offensichtlich, dass der Begriff der ‚geistigen Behinderung ’selbst so schnell als möglich anstelle der Menschen, die damit bezeichnet werden, als Un-Wort geächtet werden sollte. Mit solchen ‚Zuschreibungen‘ machen wir eine beobachtbare Erscheinung zum ‚inneren Wesen‘, zur ‚menschlichen Natur‘ desjenigen , an dem wir sie -phänomenologisch, noch dazu oft nach fragwürdigen Kriterien – beobachten! Das hat auf der Basis des heute möglichen Erkenntnisstandes mit Wissenschaftlichkeit rein gar nichts mehr zu tun“.
Der Autor Peter Hoet beschreibt das Problem der Einteilung des Menschen in Kategorien auf andere Art und Weise in seinem Roman „Der Plan von der Abschaffung des Dunkels“: „Wenn man etwas bewertet, dann ist man gezwungen, sich vorzustellen, daß es in eine lineare Werteskala einzuordnen ist, sonst kann die Bewertung nicht stattfinden. Jeder der sagt, etwas sei gut oder schlecht oder ein bißchen besser als gestern, geht davon aus, daß es ein Notensystem gibt, daß man auf eine einigermaßen klare und nachvollziehbare Weise eine Leistung mit einer Art Zahl versehen kann. Doch niemals und zu keiner Zeit hat man ein Verfahren vorgelegt, wie man Noten geben soll. Und das sage ich nicht, um jemanden in Verlegenheit zu bringen. Niemals in der ganzen Weltgeschichte konnte jemand für irgend etwas, das nur ein bißchen verzwickter ist als einfache Situationen beim Fußball oder ein Vierhundertmeterlauf, ein Verfahren beschreiben, das von verschiedenen Menschen gelernt und befolgt werden könnte, und zwar so, daß sie dieselbe Note geben würden. Noch nie hat man sich auf eine Methode einigen können, um zu entscheiden, wann eine Zeichnung, eine Mahlzeit, ein Satz, ein Schimpfwort, ein Einbruch, ein Schlag, ein Vaterlandslied, ein dänischer Aufsatz, ein Schulhof, ein Frosch oder ein Gespräch gut oder schlecht ist oder besser oder schlechter als eine andere oder ein anderer oder ein anderes. Niemals, nichts, was einem Verfahren auch nur nahe käme. Ein Verfahren aber ist wichtig, denn es stellt erst sicher, daß ganz offen und ehrlich über etwas gesprochen werden kann. Eine Verfahren ist etwas, das Menschen beizubringen wäre, […]. In der ganzen Welt gibt es kein Verfahren zur Bewertung der Qualität von zusammengesetzten Phänomenen.“ (Hoet, S. 92)
Im Folge werde ich mich auf eine Studie über Fließgewässer (Universität für Bodenkultur Wien, 1993 u. 1998) in Österreich beziehen. Ich versuche damit zu unterstreichen, wie schwerwiegend des Menschen auf diese empfindlichen Systeme auswirkt. Es wird sich zeigen, daß durch die Flussregulierungen eine Artenvielfalt an den verschiedenen Übergängen auftritt verloren geht, die besonders (z.B. Fluß/Land, unterer und oberer Flußlauf usw.) Die für Tiere und Pflanzen wichtigen Übergänge gingen vor allem durch die Flussbegradigungen verloren. Wir werden sehen, daß sich der Mensch durch die Eingriffe verschiedentlich selber in Gefahr bringt, da die Folgen (siehe Schmetterlingseffekt) unabsehbar sind.
Weiters versuche ich den Bezug zu den pädagogischen Forderungen von Huschke-Rhein (von Lüpke/Voß, S. 36ff) herzustellen, in denen die Anerkennung des Wertes der Vielfalt in Natur und Menschenwelt hervorgehoben wird. Wir sind darin aufgerufen, die Unterschiedlichkeit der uns anvertrauten Personen zuzulassen, zu unterstützen und als Pädagogen eher die Rolle des Beobachters einzunehmen.
Die Entwicklung natürlicher Systeme und damit die Entwicklung der Menschen, lässt sich nicht endgültig berechnen, unterdrücken oder formen. Das zeige ich am Beispiel der Flußsysteme. Vor allem in der Nachkriegszeit wurden viele Fließgewässer durch den Flußbau sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung massiv reguliert. Die häufigsten Eingriffe des Menschen an Fließgewässern sind:
- Kraftwerke mit ihren vielschichtigen Problembereichen (z.B. Stauhaltung, Schwellbetrieb, Ausleitung etc.)
- Regulierungsmaßnahmen durch den Flußbau und/oder die Wildbach- und Lawinenverbauung
- Abwasserleitungen mit fäulnisfähigen und/oder toxischen Inhaltsstoffen, oder thermischen Belastungen
In jedem Flußabschnitt sind die unterschiedlichen Lebensgemeinschaften vom Zusammenspiel und Wechselwirkung vieler Faktoren abhängig. Die Eingriffe des Menschen stören und verändern diesen sensiblen Faktorenkomplex oft grundlegend. Die Auswirkungen sind nicht nur lokal zu betrachten, sondern gehen weit über den unmittelbaren Eingriffsbereich hinaus.
Derzeit werden in Österreich rund 70 % der ausbauwürdigen Fließgewässerstrecken energiewirtschaftlich genutzt, in Oberösterreich sind es bereits 91 % (im Vergleich dazu: Schweiz 95 %). (vgl. Studie 1998, S. 76) Es ist z. B zu hinterfragen, ob aus volkswirtschaftlicher Sicht der Nutzen tatsächlich gegeben ist. Die Problematik der Kraftwerke wird meines Erachtens in der Studie gut am Beispiel des Nil erklärt: „Durch den Stauraum ergeben sich gewaltige Verdunstungsverluste, die Sedimentation ist wesentlich höher als erwartet. Natürliche Düngung der ursprünglich jährlich inundierten (=überschwemmten) Flächen (für die Landwirtschaft Ägyptens von grundlegender Bedeutung!) entfällt. Ein hoher Anteil der Stromausbeute ist nunmehr für die Produktion von Dünger notwendig. Düngung/Bewässerung führen zu Versalzung der Böden. Das ehemals vorwachsende Delta zeigt rückschreitende Fischereierträge im Mittelmeer. Durch Bewässerungssysteme nehmen Malaria und Bilharzinose (Trematode der Gattung Schizostoma) enorm zu. Quintessenz: Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist heute zu hinterfragen, ob die Errichtung des Assuanstaudammes ein zielführendes Projekt war.“ ( Studie 1998, S. 81)
Fließgewässer sind im Vergleich zu stehenden Gewässern extrem offene Ökosysteme. Sie sind mit ihrem begleitenden Umland aber auch dem übrigen Einzugsgebiet in wesentlich stärkerer Wechselwirkung als Seen. Die fließenden Wellen transportieren Geschiebe und Schwebestoffe, aber auch Nährstoffe u.v.m. Zwischen dem Ursprung des Flusses und der Mündung ändern sich oft die Randbedingungen (Höhenlage, Habitatausstattungen O2-Gehalt, Temperatur etc.). Betrachtet man den Längsverlauf, ergeben sich dadurch charakteristische Abfolgen unterschiedlicher Fließgewässer- Biozönosen (Lebensgemeinschaft), die z.B. in den klassischen Fischregionen zum Ausdruck kommen. (vgl. Studie, S. 65)
Die strukturelle Vielfalt des Lebensraumes spielt für aquatische Lebensgemeinschaften eine große Rolle. Die Beziehung zwischen der Mannigfaltigkeit des Lebensraumes und jener der Gewässerfauna steht im Vordergrund zahlreicher Untersuchungen. So weiß man z.B., daß naturnahe Fließgewässer mit variablen Tiefen – und Breitenverhältnissen im Vergleich zu strukturarmen Abschnitten durchwegs höhere Frischartenzahl und Verschiedenheit der Fischbestände aufweise. (vgl. Studie 1998, S. 70)
Seit dem Beginn der neunziger Jahre kam es zu einem Umdenken und zu einer Neuorientierung des Wasserbaues. Es werden nunmehr neben den Erfordernissen des Hochwasserschutzes verstärkt gewässerökologische Aspekte berücksichtigt. Die dafür notwendige gesetzliche Basis wurde v. a. mit der Novelle 1990 zum Wasserrechtsgesetz geschaffen. Damit wurde ein wesentliches Instrument zu nachträglichen Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich ökologischer Defizite geschaffen, heißt es in der Fließgewässerstudie von 1998. (vgl. S. 92)
Unter dem Begriff “ Ökologische Funktionsfähigkeit“, verstehe diese Gesetzesnovelle folgendes:
„Ökologische Funktionsfähigkeit ist die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung des Wirkungsgefüges zwischen dem in einem Gewässer und seinem Umland gegebenen Lebensraum und seiner organismischen Besiedelung entsprechend der natürlichen Ausprägung des betreffenden Gewässertyps (Erhaltung von Regulation, Resistenz und Resilienz).“ (Studie, S. 93)
Das Zusammenspiel von Gewässer, Umland und Lebewesen für die Erhaltung dieser Systeme ist sehr wichtig. Kleinste Ursachen können größte Wirkungen hervorbringen.
Folgende Parameter zur Beschreibung des Fließgewässer-Lebensraumes und seiner Zönosen sind in der Studie 1998 zusammengefaßt (S. 74): „Faktoren wie Temperatur/Sauerstoffgehalt, Fließgeschwindigkeit/Schleppkraft, Sohlsubstrat, Geschiebe/Schwebstoffe sowie Bettmorphologie/Habitatstrukturen (Strukturausstattung) dienen v. a. dazu, die Lebensraumbedingungen innerhalb des Fließgewässers (Habitatmerkmale) im Hinblick auf die Präferenz bzw. Eignung für aquatische Zeigerarten oder Lebensgemeinschaften zu beschreiben. Zugleich sind sie Grundlagen für autökologische Untersuchungen, bei denen eine einzelne Art in ihrer Beziehung zu verschiedenen Umweltfaktoren im Mittelpunkt der Forschung steht.“ (Studie, S. 94)
Der Schutz der letzten naturnahen Fließgewässerabschnitte besitzt absolute Priorität. Außerdem gilt, daß durch ökologische Verbesserungs- und Revitalisierungsmaßnahmen der Zustand der bereits degradierten Fließgewässer verbessert werden soll. (vgl. Studie 1998, S. 76) Damit diesen Ansprüchen Rechnung getragen werden kann, bedarf es einer fachübergreifenden Zusammenarbeit, wie immer wieder betont wird. (vgl. Studie, S. 94)
Die in der Studie aufgezeigten Untersuchungen weisen auf die Komplexität lebender Systeme hin. Trotzdem wird zu wenig berücksichtigt, daß wir über das Zusammenspiel innerhalb der Systeme nichts wissen. Maturana & und Varela haben in der Biologie den Begriff der Autopoiese eingeführt. Dies bedeutet, daß jedes System sich im Prinzip durch Selbststeuerung durch Selbstorganisation ständig selbst entwickelt. Überall in der Natur, wo der Mensch gewaltsam eingreift, greift er in diesen Prozeß ein. Die Auswirkung seines Eingreifens kann jedoch nicht abgesehen werden.
In der Chaostheorie wird immer auf die Bedeutung der Anfangsbedingungen hingewiesen. Diese sind bei komplexen dynamischen Systemen nie ausreichend bekannt. Deshalb wissen wir auch nicht, wo und wann das Eingreifen des Menschen letzten Endes zu einer unumkehrbaren Katastrophe führt.
Die Sensibilität sich bewegender Systeme und die Möglichkeit, daß sich kleinste Einwirkungen maximal auswirken können, ist keine völlig neue Entdeckung. Sie findet sich bereits im amerikanischen Volkslied:
„Weil ein Nagel fehlte, ging das Hufeisen verloren;
weil ein Hufeisen fehlte, ging das Pferd verloren;
weil ein Pferd fehlte, ging der Reiter verloren;
weil ein Reiter fehlte, ging die Schlacht verloren;
weil die Schlacht verloren war, ging auch das Königsreich verloren.“
(Gleick, S. 39)
Neben der Nichtlinearität sind es vor allem Rückkoppelungsprozesse, die darüber bestimmen, welchen Veränderungen ein dynamisches System unterliegt. Die Menschheit kam schon früh auf die Idee der Rückkoppelungsmechanismen. Bereits 250 v. Chr. benutzte der Grieche Ktesibios einen negativen Rückkoppelungsmechanismus in Form einer Wasseruhr um die Höhe des Wassers zu regulieren. In der Technikgeschichte wurden solche Regler vermehrt im 18. und 19. Jahrhundert eingesetzt.
Zwei Arten von Rückkoppelungsmechanismen sind uns alle bekannt. Es ist einmal die positive Rückkoppelung, die uns bekannt ist durch den ohrenbetäubenden Lärm der durch eine Lautsprecheranlage entstehen kann. Das Mikrophon fängt etwas aus dem Lautsprecher auf und schickt es zurück in den Verstärker, der es wiederum an die Lautsprecher weitergibt. Das chaotische Geräusch resultiert aus einem Verstärkungsprozeß, in dem das Ausgangssignal einer Stufe zum Eingangssignal einer anderen wird. Kleine Ursachen summieren sich auf und führen zu einem beeindruckenden Ergebnis.
Eine andere Art Rückkoppelung ist ein Heizungssystem. Ein eingebauter Thermostat reguliert die Zimmertemperatur. Sinkt diese unter einen bestimmten Wert, so antwortet der Thermostat, indem er den Brenner einschaltet, und es wird wärmer im Zimmer. Steigt die Zimmertemperatur, so meldet dieser dem Brenner, daß er abschalten muß. Was der Thermostat tut, beeinflußt den Brenner, aber ebenso beeinflußt das, was der Brenner tut, den Thermostaten. Diese Rückkoppelung nennt man eine negative Rückkoppelung.
Die Namen sind kein Werturteil, sie besagen lediglich, daß das eine System hemmt und das andere verstärkt.
„Solche grundlegenden Arten von Rückkoppelung kommen überall vor: auf allen Ebenen des Lebendigen, in der Evolution des ökologischen Gesamtsystems, in den momentanen psychologischen Abläufen bei gesellschaftlichem Umgang und in den mathematischen Ausdrücken nichtlinearer Gleichungen. Rückkoppelung verkörpert wie die Nichtlinearität eine grundsätzliche Spannung zwischen Ordnung und Chaos.“ (Briggs & Peat, S. 33) Atkins berichtet von Rückkoppelungsprozessen beim Entstehen von dissipativen Strukturen. Solche Strukturen können entstehen, wenn Energie durch ein System fließt. Führt man einem System Energie zu, kann es aus dem thermischen Gleichgewicht geraten. Erhöht sich der Energiefluß durch das System gibt es Wärme an seine Umgebung ab. Ein solcher Energieaustausch kann unter bestimmten Umständen die Ordnung oder die Struktur in einem System, das weit vom Gleichgewicht entfernt ist, erhöhen. In Flüssigkeiten können sich Muster bilden, deren Auftreten man nicht voraussehen kann. (vgl. Raven, S. 37) Ein Beispiel in der Physik sind dafür die sogenannten Benardschen Zellen.

Abb.1: Bénard-Zellen ( Jantsch, S. 53)
Bénard-Instabilität:
Bereits um 1900 beschrieb Bénard (vgl. Jantsch 1992) mit einem von ihm durchgeführten Experiment das Prinzip der Selbstorganisation in Komplexen dissipativen Systemen. Erst später gelang die Erklärung mit Hilfe des zugrundeliegenden Phänomens der Nichtlinearität.
Diese entstehen durch Konvektionsströme in einer dünnen Flüssigkeitsschicht, die auf der Unterseite geheizt wird und auf der Oberseite abkühlt. Solange das Temperaturgefälle innerhalb der Schicht gering ist, bewegen sich die Flüssigkeitsteilchen chaotisch in alle Richtungen. Wenn der Temperaturunterschied so groß wird, daß die kalte Flüssigkeit an der Oberseite im Verhältnis zur heißen an der Unterseite merklich dichter wird, tritt die sogenannte Bénardsche Instabilität auf: kalte Flüssigkeit sinkt abwärts, während heiße aufsteigt; dadurch kommt eine Zirkulation in Gang, die ein wabenähnliches Muster – die Bénardschen Zellen – entstehen läßt. Diese sechseckigen Konvektionszellen bestehen aus unzählbaren Mengen von Molekülen. Diese organisieren sich selber über große Flächen zu einem komplexen Muster. Der Systemzustand wird durch die Dissipation (Zerstreuung) der Energie solange aufrecht erhalten, solange eine bestimmte Temperaturdiffernz gehalten wird.
Das Überschreiten des jeweils kritischen Punktes an dem entweder Konvektionszellen entstehen oder zerfallen, ist geichzusetzen mit dem Überschreiten eines Bifurkationspunktes (siehe Pkt. 4.8). Drei grundlegende Bedingungen für das Auftreten von dissipativen Strukturen in chemischen Reaktionssystemen sind
- Offenheit gegenüber der Umwelt und Austausch von Energie und Materie mit ihr,
- ein Zustand fern vom Gleichgewicht und
- die Beteiligung von autokatalytischen Stufen. (vgl. Jantsch S. 93)
Anhand dieser Reaktionsschritte können auch Prozesse beschrieben werden, die nicht chemischer Natur sind. In einem Ökosystem zum Beispiel besteht die autokatalytische Stufe in der Selbstreproduktion einer bestimmten Art, die aber vom Vorhandensein eines genügend großen Nahrungsangebotes abhängt. Ich versuche die Schritte anhand eines Raubtier-Beute-Systems zu erklären. In einem See leben Forellen und Hechte. Die Hechte angenommen haben genügend Forellen zum Fressen, dadurch können sie sich praktisch unbegrenzt vermehren. Dies geschieht auf Kosten der Forellen. Die „Überbevölkerung“ der Hechte beginnt an Hunger einzugehen, da zuwenige Forellen vorhanden sind. Jetzt beginnt sich die Art der Forellen wieder zu erholen. Nach und nach können sich auch die Hechte wieder vermehren, wenn genügend Forellen vorhanden sind. Es entsteht eine Schwingung zwischen der Zahl der Hechte und der Zahl der Forellen, das alle paar Jahre abwechselnd seinen höchsten und seinen tiefsten Wert erreicht.

Abb. 2: Kombiniertes Raubtier-Beute-System (Briggs/Peat, S. 52)
Die Schritte, die dabei erfolgen, laufen autokatalytisch ab. Autokatalyse ist eine Grundbedingung für die Existenzfähigkeit sich selbstorgansierender Systeme. Das heißt, die Produkte irgendeiner Teilreaktion sind gleichzeitig Reaktionspartner für einen früheren Schritt. Dadurch kann es zu einer positiven Rückkoppelung kommen: Einige Substanzen kurbeln ihre eigenen Produktionen an. Mitunter tritt auch umgekehrt eine negative Rückkoppelung auf. Dann hemmt eine Substanz die Reaktion, in der sie entsteht.
Rückkoppelungsmechanismen sind aber auch dazu wichtig, daß sich ein System weiterentwickeln kann. Das soll im Folgenden an einem Beispiel der Evolution gezeigt werden.
Biologen glauben, daß Rückkoppelungsprozesse dazu betragen, daß Systeme über lange Zeit ihre Form beibehalten. Jedoch verwenden sie diese Prozesse auch dazu, daß sie sich in Richtung höherer Gestalt katapultieren.
Der Biologe Howard Pattee beschreibt dies folgendermaßen:
„Nehmen wir z. B. die Bakterien. Diese ersten Lebensformen auf der Erde haben keinen Zellkern. Sie vermehren sich einfach, indem sie sich teilen, also Kopien von sich selbst herstellen. Bakterien haben auch die Fähigkeit, untereinander – durch einen Prozeß, der nicht Fortpflanzung ist – Stücke genetischen Materials auszutauschen. Das bedeutet , daß alle Bakterien der Welt gegenseitig Zugang zu ihren jeweiligen genetischen Vorräten haben. Durch ständige Iteration von Material im genetischen Pool können sich daher Bakterien sehr rasch an wechselnde Bedingungen anpassen. Die Schattenseite dieser biologischen Form der Selbstbezüglichkeit ist jedoch, daß es unter Bakterien keine wirklichen Individuen gibt. Wegen der Selbstrückkoppelung bei Herstellung von Kopien gibt es nur die verschiedenen Abstammungslinien von Klonen. [..] Ein Nachteil ist jedoch die begrenzte Komplexität der Lebensformen, die sich durch diese Methode entwickeln lassen. Nach einer Theorie überzog diese erfolgreiche Iteration die ganze Erde mit Bakterien. Dies brachte chaotische Bedingungen hervor, denen dann eine neue selbstbezügliche Schleife entsprang: Die Sexuelle Fortpflanzung. Dadurch wurde ein neuer, unglaublich kraftvoller Entwicklungsschub ausgelöst.“ (Pattee in: Briggs & Pest, S. 94f)
Jedes der beschriebenen Stadien entsteht in unvermeidbarer Weise als Folge des Vorangegangenen . Ich habe dieses Beispiel deshalb erwähnt, da an ihm augenscheinlich wird, wie wichtig sowohl Stabilität als auch Weiterentwicklung sind.
Ein ganzheitliches Menschenbild sieht den Menschen als Einheit von Biologischem, Psychologischem und Sozialem.
Der Mensch ist ein soziales Wesen, das sich nicht allein, sondern nur in Beziehung mit anderen entwickeln kann. René Spitz unterstreicht mit der Funktion des Dialogs die Wichtigkeit des ständig ablaufenden Rückkoppelungsprozesses zwischen Mutter und Kind. Das Verhalten der Mutter beeinflußt das Verhalten des Kindes und umgekehrt, aber nicht im Sinne eines Reiz-Reaktionsschemas, sondern im Sinne einer ständigen Weiterentwicklung in Richtung höherer Komplexität. (siehe Pkt. 7)
Die Entwicklung des Menschen geschieht in der ständigen Auseinandersetzung zwischen der Person und ihrer Umwelt, wobei sich Veränderungen auf beiden Seiten wechselseitig bedingen können. Ich beziehe mich im Folgenden auf Rainer K. Silbereisen (in: Lüpke/Voß, S. I2ff) der in fünf Grundsätzen darzustellen versucht, wie sich das Wechselspiel von Person und Kontext bei Entwicklungsprozessen Beschreiben läßt. Entwicklung wird dabei als Prozeß verstanden, der die Zeit von der Konzeption bis zum Tod umfaßt.
Silbereisen versteht unter Entwicklung, Veränderungen, soweit sie sich sinnvoll auf eine Zeitdimension beziehen lassen. „Die Zeitdimension, die in diesem Zusammenhang am häufigsten bedacht wird, ist das chronologische Alter. Dabei muß klar sein, daß hiermit nur eine Art Kürzel gemeint ist, welches für die eigentlichen Einflüsse steht, die über ihre Korrelation mit dem Alter indirekt erfaßt sind. Neben dem chronologischen Alter kann man Entwicklung genauso gut, wenn nicht besser, durch Veränderungen auf Zeitmaßstäben beschreiben. Ein Beispiel hierfür sind die sogenannten Entwicklungsaufgaben, die für bestimmte Lebensabschnitte einigermaßen umschrieben und halbwegs allgemein geteilte Anforderungen und Vorrechte heranwachsender Personen festlegen.“ (Silbereisen in: Von Lüpke/Voß, S. 13)
Silbereisen geht im zweiten Punkt auf die Wechselwirkung von Person und Umwelt ein. Wesentlich scheint die Aussage, daß Entwicklung dem Individuum nicht widerfährt, sondern, daß es je nach Alter und psychosozialen Kompetenzen, seine Entwicklung und ihre Ergebnisse selber beeinflußt. Zum einen wird die Entwicklung durch die Interaktion zwischen Person und Umwelt beeinflußt, zum anderen kann die Person jedoch auch aktiv und planvoll ihre Entwicklung selber bestimmen. Im ersten Fall bezieht sich Silbereisen auf die Ergebnisse einer Zwillingsforschung. „Betrachtet man die Intelligenz eineiiger Zwillingspaare, so findet sich, wie nicht anders zu erwarten, ein hoher Zusammenhang. Interessant ist aber, daß die Korrelation in der Kindheit niedriger ist als in der Jugend. Auf den ersten Blick erscheint dies erwartungswidrig, weil man bei genetischen Einflüssen, die für Intelligenz gut abgesichert sind, eher daran denkt, daß sie am Anfang des Lebens, wenn die Umwelt noch nicht sehr viel Einfluß nehmen konnte, stärker sind.“ (von Lüpke/Voß, S. 15) Die Frage ist, warum im Jugendalter die Korrelation höher ist als in der frühen Kindheit Silbereisen findet folgende Erklärung: „Entsprechend den sozialen Vereinbarungen unserer Kultur haben Jugendliche mehr Freiheit, sich so zu verhalten, ihnen entspricht, während Kinder stärker in ihrem Verhalten durch die häusliche Umgebung beeinflußt sind. Die höhere Korrelation im Jugendalter kommt also Zustand, weil dies sozusagen der erste Abschnitt im Leben ist, zu dem sich der Genotyp voll entfalten kann, nicht länger beeinträchtigt durch möglicherweise die Unterschiede nivellierender (gleichmachen, verflachen) familiärer Erziehung während der Kindheit.“ (von Lüpke/Voß, S. 15)
Die Einflussnahme der Person auf ihre Entwicklung wird im Jugendalter deutlich. “ Hier macht es bei vielen Veränderungen Sinn anzunehmen, daß Jugendliche mit Bewußtsein und /oder mehr oder weniger deutlicher Absicht etwas für ihre eigene Entwicklung bewirken.“ (von Lüpke/Voß, S. 15) Entwicklungsaufgaben werden zum Beispiel dadurch vorangetrieben, daß sich Jugendliche in ihrer Freizeit bestimmten Erfahrungen aussetzen Als Beispiel kann das Problemverhalten von Mädchen erwähnt werden. Von ihrer äußeren Erscheinung wirken sie oft älter als sie sind. Dies kann zu Unsicherheiten führen, die sie dadurch lösen, daß sie sich älteren Jugendlichen anschließen. Diese verhalten sich bereits erwachsener. Dabei kann es während dieser Zeit zu verschiedenen Problemen kommen. Zum Beispiel kann es dabei zu Alkohol- und Drogenkonsum kommen, der nach der sozialen Norm nicht legitim ist. Allerdings hat dies nicht unbedingt negative Auswirkungen auf das spätere Leben. „Wichtig ist, daß Einflussnahme des Individuums auf die eigene Entwicklung sowohl ganz an den Anfängen des Lebens, wie im hohen Alter möglich ist“, wie Silbereisen betont. (von Lüpeke/Voß, S. 16)
Dort, wo die Person versucht aktiv ihre Entwicklung voranzutreiben, tut sie dies unter Einflußnahme der Umwelt. Sie versucht eine Übereinstimmung der Forderungen von außen den eigenen Erwartungen herzustellen. Wichtig sind dabei Rollenübergänge. So gibt es keine soziale Norm darüber, ab wann es wichtig ist, einen gegengeschlechtlichen Freund/Freundin zu haben. Dennoch gibt es über Zeit und Abfolge eine klare Übereinstimmung unter den Jugendlichen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Leitbilder, die für das eigene, auf Entwicklung ausgerichtete Handeln eine Bezugsnorm darstellten. Kann diese Zielsetzung nicht erreicht werden, wird dies als eigenes Versagen und eine Entwertung des Selbstwertes erlebt.
Silbereisen bezieht sich auf einige Merkmale die wichtig sind, damit Entwicklung im oben genannten Sinn gelingen kann. „Positiv sind ein zugewandtes Temperament in der frühen Kindheit, ferner warme, sichere Familienbeziehungen, schließlich Vorbilder und Unterstützung von Menschen außerhalb der Familie. [… j Weitere Merkmale wären zu nennen, wie Autonomie, Empathie, realistische Kontrollüberzeugungen, positiver Selbstwert, gute Beziehungen zu Gleichaltrigen. Fähigkeiten zum Problemlösen und überlegten Entscheiden.“ (von Lüpke/Voß, S. 19) Diese Faktoren können als entwicklungsförderliche Personenmerkmale bezeichnet werden. Sie bilden sozusagen einen „besonderen Schutz“, so daß die Person unter Umständen auch unter schwierigsten äußeren Verhältnissen (Armut, Scheidung, Krankheit, …) unbeschadet überstehen kann.
Eine bedeutende Rolle im Entwicklungsprozess spielt der ökologische Kontext. Besondere Herausforderungen entstehen an verschiedenen Übergängen. Silbereisen unterscheidet normativ-altersgradierte, wie Kindergarten, Schuleintritt oder Schulabschluss, von nicht-normativen Lebensereignissen, wie Übersiedlung, Verlust des Arbeitsplatzes, Übersiedlung ins Altersheim u.v.m. In solchen Situationen müssen wir uns neu orientieren, weil nicht mehr gilt, was gewohnt war. Wir müssen dabei meist mit einer Vernetzung neuer Kontexte zurecht kommen.
Diese Beispiele sollen aufzeigen, daß Entwicklung immer im sozialen und interpersonalen Kontext stattfindet, und sich eine Wechselwirkung zwischen den Beteiligten ganz von selbst ergibt. Entwicklung ist immer Ko-Entwicklung wie Silbereisen aufzeigt.
Nach Maturana & Varela ist jedes Lebewesen eine Einheit, die sich im ständigen Wandel befindet. Dieser strukturelle Wandel findet in der Einheit in jedem Augenblick statt: Entweder aus der eigenen inneren Dynamik oder durch Einwirkungen aus dem umliegenden Milieu, wobei das Milieu lediglich dazu beträgt, daß Entwicklung stattfinden kann. Veränderung kann von außen nie aufgezwungen werden, sondern nur durch das System selber stattfinden, das aufgrund der eigenen Dynamik neue Verbindungen und Strukturen eingehen kann. Das Individuum entwickelt sich durch die Umgebung die Umgebung entwickelt sich aber auch durch das Individuum. Entwicklung wird deshalb immer als Ko-Entwicklung gesehen. Es geht dabei um einen ständig ablaufender Rückkoppelungsprozess zwischen Individuum und Umwelt. Wobei in einer Art Spirale das Verhalten des einen immer ein Verhalten des anderen nach sich zieht und umgekehrt.
Das Eingreifen des Menschen in die Natur hat unabsehbare Folgen. Wir kennen bei lebenden dynamischen Systemen nie alle Anfangsbedingungen. Würden sie uns jedoch auch alle bekannt sein, wüßten wir nicht welcher Faktor gerade mit welchem anderen Faktor in Beziehung steht und wo welche Rückkoppelungsmechanismen bestehen um ein System stabil zuhalten. Dies wird durch die Fließgewässerstudie klar.
So heißt es in der Fließgewässerstudie (1993): „Wie schon weiter oben aufgezeigt, ist die Lebensgemeinschaft eines bestimmten Flußabschnittes von Zusammenspiel und Wechselwirkung zahlreicher abiotischer und biotischer Faktoren abhängig. Anthoprogene Eingriffe und Nutzungen stören/verändern diesen sensiblen Faktorenkomplex vielfach grundlegend. … Bei vielen der genannten Einflüssen (Kraftwerke, Regulierungsmaßnahmen, Abwassereinleitungen, etc…) ergeben sich für die Fließgewässerbiozönosen nicht nur lokale Auswirkungen, sondern weit über den unmittelbaren Eingriffsbereich hinaus wirksam werdende Folgen. … In manchen Fällen bewirken die Eingriffe Extrembiotope in Thienemann’schem Sinn: Stake gestörte Lebensräume werden dabei nur mehr von wenigen spezialisierten Formen, aber in hoher Dichte besiedelt.“ (Studie, S. 76)
Die ursprüngliche Fischfauna der frei fließenden Donau war von rheophilen Vertretern dominiert (Nase, Barbe, Huchen, etc.), die auf Kies- und Schotterbänken des Hauptflusses und/oder der Zubringer laichten. In Stauräumen finden genannte Arten nur noch im Stauwurzelbereich vereinzelte Reproduktionsareale bzw. Laich-, Brut- und Jungfischhabitate. Aber auch bezüglich der Nahrungsbasis sind die rheophilen Fischarten im wesentlichen auf die Benthosorganismen kiesig/schottriger Sohlbereichc angewiesen. Die oben beschriebene Sand- und Schlammfauna kann von genannten Fischarten nur zum Teil bis gar nicht genutzt werden.
Indifferente und vor allem stagnophile Fischarten waren in der frei fließenden Donau von untergeordneter Bedeutung und vor allem hinsichtlich ihrer Reproduktion auf die angrenzenden Augewässer und Inunaditionsflächen angewiesen. In den Stauräumen selbst laichten viele Vertreter dieser beiden Gruppen aufgrund zu niedriger Wassertemperatur und fehlender Laichsubstrate nicht. Das hohe Nahrungsangebot der Schlammbänke wird von zahlreichen Vertretern dieser Gruppe zwar potentiell genutzt, doch sind deren Bestandsdichten zufolge reduzierter natürlicher Reproduktion niedrig. In Deutschland werden Laufstaue daher häufig als ‚Hybridgewässer‘ bezeichnet, in denen z. B. die ökologischen Faktoren Wassertemperatur und Sohlsubstrat nicht zusammenpassen.
Folgendes Beispiel zeigt, welche unmittelbaren und sichtbaren Ergebnisse das Eingreifen des Menschen in die Fließgewässer für die Fische innerhalb kürzester Zeit haben kann:
„Im Inn lebten ursprünglich 24 Fischarten. Durch die Errichtung des 1. bayrischen Kraftwerkes im Jettenbach brach am Tiroler Inn die Berufsfischerei bereits im Folgejahr (!) zusammen. Heute sind in diesem Bereich nur mehr zwei Fischarten (Bachforelle und Äsche) auf Basis natürlicher Reproduktion bestandsbildend. (Studie, S. 78)
Mögen uns die Probleme der Berufsfischer auch nicht direkt betreffen, so müßte man doch bedenken, daß vielleicht durch unser Eingreifen, viele Mechanismen gestört werden die auch unmittelbare Auswirkungen auf den Menschen haben. Vielleicht werden diese Auswirkungen nicht so schnell sichtbar. Auf die Dauer gesehen, kennen wir die Veränderungen jedoch nicht. Wir wissen nicht, welche Änderungen die Eingriffe in den Temperaturhaushalt der Flüsse hat und was das wiederum auf die Temperaturveränderungen der gesamten Umgebung haben wird. Die Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt (z. B. starkes Absinken) sind uns zum Teil schon bekannt. Genauso die Auswirkungen der Veränderung der Fließgeschwindigkeit (katastrophenartige Überschwemmungen)
Sind uns auch viele Rückkoppelungsmechanismen inzwischen bekannt, wie z. B. viele Nahrungsketten, so kennen wir viele noch nicht. Deshalb wissen wir auch nicht, was wir stören und welche gewaltigen Veränderung wir letzten Endes auslösen und welche neuen Prozesse wir dadurch in Gang setzten. Lang erprobte Überlebensstrategien von Lebewesen werden verändert und gehen vielleicht für immer verloren.
Rückkoppelungsprozesse im Bereich des Psychischen stellt Wolinsky (vgl. Wolinsky 1996) fest. Er geht davon aus, daß sich das subjektive Universum jedes Menschen selber entwickelt.“ Das heißt, daß unsere Überzeugungen bestimmen, wie wir unsere Erfahrungen interpretieren und somit erleben, und sie geben auch vor, was wir erleben. […] Sobald sich eine Überzeugung verfestigt, wird sich der einzelne ausschließlich auf die Erfahrungen begrenzen, die seine Überzeugungen bestätigen“ (Wolinsky 1996, S 43) Praktisch gesehen, bedeutet das, wenn wir der Überzeugung sind, daß das Leben hart ist, werden wir diese Erfahrung auch machen. „Man könnte sagen, daß Überzeugungen als Kontrollparameter für das Ergebnis eines Verhaltensmusters agieren.“ (S. 44) Jeder Mensch schafft sich mit seinen Überzeugungen gewisse Grenzen. Diese treten in der Psyche als immer wiederkehrende Muster auf.
In der Psyche wird unser Selbst durch Rückkoppelungsschleifen unserer Überzeugungen gebildet. Dies trägt zum einen zu einer Stabilität unseres Selbst bei.
Wolinsky schreibt: „Diese Selbstorganisation unseres inneren Universums zur Aufrechterhaltung des eigenen Gleichgewichts verursacht schwerwiegende psycho-emotionale Begrenzungen. Dies geschieht, weil wir psycho-emotional einen zugrundeliegenden Zustand haben, den wir unabsichtlich dadurch, weil wir uns selbst organisieren, aufrechterhalten. Allgemein gesagt, werden wir alle Störungen dieses zugrundeliegenden Zustandes und unserer Selbstorganisation zurückweisen und nur solche lnformationen akzeptieren, die unsere Sicht von uns selbst und der Welt bestätigen.“ (Wolinsky, S. 46) Als Beispiel führt er an: „Wenn Sie ‚Ich werde zurückgewiesen‘ als Bezugspunkt aufrechterhalten und ich dann sage, ‚Ich mag Sie‘, können Sie diese Information innerlich nicht zulassen, denn sie stört Ihren selbstorganisierenden Bezugspunkt. Um diese chaotische Störung Ihres selbstorganiserenden Bezugspunktes zu bekämpfen, können Sie mich zuerst zurückweisen, damit ich mich Ihnen gegenüber ablehnend verhalte und so Ihren selbstorganiserenden Bezugspunkt ‚Ich werde zurückgewiesen‘ bestätigen und aufrechterhalten.“ (Wolinsky 1996, S 46f)
Jedes dynamische System hat die Tendenz, sich dem mit dem Wort „Attraktor“ bezeichneten Zustand zu nähern. Dieser Begriff dient der qualitativen Beschreibung dynamischer Systeme. Betrachten wir z. B. ein Fußballspiel, in dem der Ball nicht sichtbar ist. Die Spieler würden hin und her laufen einmal in diese einmal in eine andere Richtung. Ihr Verhalten würde uns nicht sofort als logisch erscheinen. Erst nach einer gewissen Zeit stellen wir fest, daß es durchaus Sinn macht, wie sich die Spieler auf dem Feld bewegen und wir werden aus den logischen Schlüssen, die wir aus unseren Beobachtungen ziehen, einen Ball hineingeben. Dieser Ball hätte die Funktion eines Attraktors. Die Bewegung der Spieler erhält dadurch Sinn.
Ein Attraktor ist ein Gebiet im Phasenraum, das eine ‚magnetische‘ Anziehungskraft auf ein System ausübt und dieses anscheinend ganz in sich hineinziehen will. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die energetische Betrachtung von Attraktorenwirkungen. Natürliche Systeme, werden von Energietälern (Attraktoren) angezogen und von Energiebergen (Repellor) abgestoßen. (vgl. Ciompi, S. 140) Es entsteht dabei eine Art Landschaft, in der die Bahnen des Attraktors verlaufen, diese nennt man Phasenraumbahnen.
„Attraktoren sind Bereiche im sogenannten Zustandsraum oder Phasenraum, auf welche die Systemdynamik obligat zutreibt, beziehungsweise innerhalb deren sie sich notwendigerweise abspielt,“ wie es Ciompi (S. 140) ausdrückt. Feuser sieht Attraktoren als einen Faktor, der an strukturbildenden Prozessen teilnimmt. Attraktoren bestimmen der Tendenz nach die Richtung und Geschwindigkeit, mit der ein System driftet, also auch die Verzweigung der Driften in neue Ströme und mithin die Evolution (Entwicklung) beeinflussen.
Attraktoren sind eng mit dem Begriff Phasenraum verbunden. Der Phasenraum ist ein abstrakter Raum, den man mit Hilfe einer Karte darstellen kann.
Karten sind anschauliche Bilder, die es unserem Denken erlauben, daß es sich auf Aspekte der Realität konzentrieren kann, die sonst all zuleicht in den Details verlorengehen. Als Beispiel erscheint mir sehr anschaulich eine Wander- oder Kletterkarte. Der Kletterer kann sowohl die Länge des Weges als auch die Höhendifferenz ablesen.
Sie hilft ihm bei der Berechnung seiner Route. „Ganz ähnlich bei Wissenschaftlern. die die Wirklichkeit eines veränderlichen Systems – eines ‚dynamischen Systems‘ – erforschen wollen: sie benutzen eine ‚Karte‘, die die Dynamik anschaulich macht, d. h. die Art, in der sich das System bewegt und verändert.“ (Briggs & Peat, S. 42)
Der Phasenraum ist ein Phantasieraum (ein Zustandsraum) in dem die Bewegung des Systems dargestellt wird. Im Phasenraum kann man so viele Dimensionen darstellen, wie sie der Wissenschaftler braucht, um die Bewegung eines Systems zu beschreiben. Der Zustand eines Systems erscheint dann in jedem Augenblick als ein Punkt in diesem Phasenraum. Die Geschichte des Systems ist dann durch eine Linie im Phasenraum dargestellt, die man auch „Bahn“ nennt. Verwendet werden solche Karten auf viele Arten: für äußerst stilisierte Karten von Untergrundbahnen, Wetterkarten, Karten, die Tiefe von Flüssen und Höhen von Gebirgen angeben, für die Darstellung psychischer Zustände, für ökologische Systeme, in denen die Populationsgröße verschiedener Arten dargestellt werden soll etc. Besitzt ein System zum Beispiel in einem Gebiet des Phasenraums einen Attraktor, der ein größeres Gebiet beherrscht, ist dieses System stabil und dissipativ. Es kann jedoch an einem anderen Ort im Phasenraum einen Staub aus winzigen Attraktoren aufweisen, dann kann das System allein durch einen winzigen Anstoß seinen Zustand verändern.

Abb. 3: Verschiedene Typen von Attraktoren (Ciompi, S. 141)
In der klassischen Mechanik und Thermodynamik kennt man zwei verschiedene Arten von Attraktoren. Im einfachsten Fall ist der Attraktor ein Punkt, demzufolge bezeichnet man ihn als Punktattraktor.
Punktattraktor:
Dieser Attraktor entspricht einem gedämpften System, in dem die Entropie zunimmt. Bewegungsenergie wird in Wärme umgewandelt, und das System strebt einem Zustand der Ruhe zu, d.h. die Bahn im Phasenraum bewegt sich auf einen Punkt zu. Ein praktisches Beispiel ist ein hüpfender Ball, der allmählich auf dem Boden zur Ruhe kommt.
Grenzzykelattraktor:
Ein System folgt einem Grenzzykelattraktor, wenn es eine ähnliche Entwicklung immer wieder durchläuft. Überall in der Natur findet man Systeme mit einem periodischen Verhalten. Solche Systeme sind zum Beispiel Raubtier-Beutesysteme. In der Natur gibt es viele Systeme, die trotz einer zum Teil heftigen inneren Dynamik einen stabilen Grenzzyklusrahmen besitzen. Man kann auch mehrere solcher Systeme zusammenkoppeln, dabei kann sich ein funktionell übergeordneter Grenzzykelattraktor herausbilden.
Solche Systeme widerstehen mit Hilfe der Rückkoppelung kleinen Störungen und versuchen in einem bestimmten Rhythmus zu bleiben. „Die Fähigkeit von Grenzzyklen, mit Hilfe von Rückkoppelung einer Veränderung zu widerstehen, ist eines der Pardoxa. die die Wissenschaft vom Wandel entdeckt hat,“ erklären Briggs & Peat (S. 50)
Der seltsame Attraktor:
David Ruell, Physiker vom Institut des Hautes Etudes Scientifiques in Frankreich und der holländische Mathematiker Floris Takens, suchten nach Mustern in Fließbewegungen und entdeckten dabei eine Art Attraktor, der sich nicht einordnen ließ, deshalb nannten sie ihn den seltsamen Attraktor. Es handelt sich dabei um „chaotische“ Entwicklungen, bei denen das System sich weder einem Ruhezustand nähert, noch sich im Kreis bewegt, sondern immer wieder neue Werte innerhalb desselben Gebiets durchläuft. Das System kann sich jedoch auch von keinem Attraktor anziehen lassen und im Verlauf seiner Entwicklung alle möglichen Punkte eines bestimmten Phasenraum-Gebietes durchlaufen. Das Verhalten eines realen Systems kann nur für einen begrenzten Zeitraum vorhergesagt werden. Sobald sich herausstellt, daß eine kleine Abweichung zwischen den angenommenen und den tatsächlichen Anfangsbedingungen besteht, wird es sich schrittweise auf einen ganz anderen Zustand hin entwickeln als erwartet.
Edward Lorenz, ein amerikanischer Meterologe vom Massachusetts Institut of Technology, entdeckte 1960 einen seltsamen Attraktor bei der Wettervorhersage. Er arbeitet mit einem Computer und ließ in der Berechnung einige Dezimalstellen aus, was einen Unsicherheitsfaktor von einem Zehntel Promille entsprach, nach einiger Zeit jedoch zu einer ganz entscheidenden Veränderung im Verhalten des Systems führte. Lorenz stellte mit dieser Entdeckung fest, daß ein komplexes System wie das Wetter im Prinzip für längere Zeit nicht vorhergesagt werden konnte. Jede noch so kleine Abweichung in den Anfangsbedingungen konnte zu einem gänzlich anderen Ergebnis führen. Vielen Forschern wurde bewußt, daß in jedem lebenden System jederzeit durch jede Kleinigkeit die Möglichkeit zur Erzeugung von Chaos und Unvorhersagbarkeit verborgen liegt. Viele Elemente stehen in komplexer Wechselbeziehung und führen zu einer prinzipiellen Nichtvorhersagbarkeit, so wie z. B. Stürme und Niederschläge aber auch Ökosysteme, Wirtschaftsgebilde, in der Entwicklung befindliche Embryonen und das Gehirn sind Beispiele für eine komplexe Dynamik. Der Lorenz-Attraktor ist als schmetterlingsähnliche Figur bekannt geworden.

Abb. 4: Lorenz-Attraktor (Raven, S. 141)
Es gibt bestimmte Regeln, die den Übergang eines Systems von der Ordnung ins Chaos beschreiben. Diese Regeln haben universelle Gültigkeit. Sie sind einfach und fuhren doch zu verblüffenden Ergebnissen.
Ciompi schreibt: „Aus Punkt- oder Kreisattraktoren vermögen unter Energiezufuhr in einem dynamischen System zunehmend komplexe torusförmige und schließlich seltsame Attrakatoren zu werden. Umgekehrt können sich seltsame Attraktoren oder Tori bei abnehmender Energiezufuhr zu Grenzzykel oder Punktattraktoren entspannen. Sämtliche Attraktoren sind aber auch typische ‚Energiesenken‘, das heißt Zustände relativ geringeren Energieaufwandes im Vergleich zu ihrem Umfeld. Mit anderen Worten, die Trajektorien (Bahnen) innerhalb eines Attraktors entsprechen immer den Wegen des geringsten Widerstands in Anbetracht der vorliegenden Energieverhältnisse – also nichts anderem als ‚Lustwegen‘. (Ciompi, S. 143)
Mit seltsamen Attraktoren schließlich läßt sich heute die nichtlineare Dynamik einer ständig wachsenden Zahl von physikalischen, chemischen, biologischen und zunehmend auch psychosozialen Vorgänge beschreiben. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang immer wieder von der Entwicklung von Galaxien und anderen kosmischen Erscheinungen wie der Saturnringe oder des roten Flecks auf dem Planeten Jupiter über die Turbulenz in Gasen und Flüssigkeiten bis zu den Rösslersprüngen des Wetters, zu den Baugesetzen von Termitenhaufen oder Großstädten und zu den Fieberkurven der Börse berichtet. Aber auch bei Rhythmen, bei denen man eine Regelmäßigkeit annehmen würde, wie z. B. der Herzschlag oder Rhythmen der elektroencephalographisch registrierten Hirnströme, lassen sie sich feststellen. „Eine rigide, durch sofortige Reaktion auf kleine Außeneinflüsse nicht mehr flexibel modulierbare Grenzzyklus-Periodizität (dagegen) wäre in beiden Bereichen dysfunktionell und krankhaft. Ganz entgegen der naiven Annahmen, Chaos sei in jedem Fall schlecht, stellten deterministisch-chaotische Dynamismen dank ihrer feinen Reaktionsfähigkeit etwas funktionell ausgesprochen Sinnvolles dar.“ (Ciompi, S. 143)
Aus chaostheoretischer Sicht geht es in der Betrachtung von Entwicklung nicht mehr um ein rein reduktionistisches Denken sondern um das Verstehen von Prozessen. Es wird nach neuen Wegen gesucht, Prozeßbildung auf verschiedenen Ebenen (biologisch, psychisch, sozial) und in verschiedenen Disziplinen (Biologie, Kultur, Wirtschaft etc.) zu verstehen. Fundamentale Gesetze werden gesucht, die all diesen Bereichen zugrunde liegen. Es genügt dabei nicht mehr, Systeme bis in ihre grundlegendsten Teile zu verstehen, sondern um die Dynamik ihres Zusammenspiels, das letzten Endes eine für uns sichtbar gewordene Form ergibt. „Was wir als Teile sehen, ist nur ein Muster in einem untrennbaren Gewebe von Zusammenhängen“, wie es Fritjof Capra ausgedrückt hat. (Capra/Rast 1994, S. 13)
In einem ganzheitlichen Menschenbild ist der Mensch prinzipiell nur denkbar als eine Einheit aus Biologischem, Psychischem und Sozialem. „Sie (biologische, psychische und soziale Ebene) stellen in der genannten Reihenfolge eine Hierarchie dar, deren Beziehung untereinander darin bestehen, daß die jeweils höhere Ebene stets die führende bleibt, sie sich aber nur mit Hilfe der tiefer liegenden Ebene, die sie in der Evolution hervorgebracht hat, realisieren kann.“ Jede Ebene hat ihre eigenen Systemgesetzmäßigkeiten, die aber jeweils nur unter Berücksichtigung des Ganzen sinnvoll erscheint und nie isoliert betrachtet werden darf. (Feuser in Merz, S. 106)
Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die vernetztes Denken von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen fordern. Zusammenhänge, zwischen Emotion und Kognition als unablässiger Prozeß der Selbstschöpfung, sind noch unzureichend erforscht. Bei der Entstehung von Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, sind die Auswirkungen seelischer Einflüsse auf den Hormonhaushalt noch viel zu wenig bekannt.
Innerhalb verschiedener Disziplinen findet ein Umdenken statt. Vester schreibt, daß man in der Biologie beginnt, sich vermehrt um die Wechselwirkungen zwischen den Zellen, aber auch die Wechselwirkung von seelischen Einflüssen und der Immunabwehr des Körpers zu beschäftigen. Wechselwirkungen zwischen den Erbinformationen in den Genen und Hormonen werden untersucht. Hormone aktivieren zum Beispiel viele Gen-Abschnitte und setzen damit vieles in Gang: die Herstellung von Enzymen, die plötzliche Umsetzung von chemischen Substanzen und viele andere. In besonders dramatischer Weise erklärt Vester, welche Metamorphose Hormoneinwirkungen beim Axolotl auslösen können: „Der Axolotl ist ein mexikanischer Wasserlurch, der normalerweise im Kaulquappenzustand lebt. Wenn man diesem Tier ein Schilddrüsenhormon injiziert, dann macht es eine Metamorphose, eine Verwandlung durch. In dem Erbmaterial werden also bisher zugedeckte Texte abgelesen. … So entwickelt sich aus diesem Tier plötzlich ein völlig anderes. Es bekommt Füße und Beine, der Schwanz verändert sich, die Kiemen bilden sich zurück, und es entsteht eine Art Landtier, und zwar ein Tier, das es normalerweise überhaupt nicht gibt.“ (Vester, S. 21).
Die Dynamik der oben angeführten Attraktoren gibt uns die Möglichkeit, neue Betrachtungsweisen in den verschiedenen Bereichen menschlicher Existenz zu geben.
Üblicherweise wird der kranke oder behinderte Mensch anhand seiner Defekte beurteilt. In Form von Diagnosen werden Aussagen über Menschen gemacht, die nicht selten zu Attraktoren werden, die einen gefährlichen Stigmatisierungsprozeß einleiten, der nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Wobei Zugehörigkeit zu einer „falschen“ Rasse, Nation oder Religion und jeder noch so geringe körperliche Defekt als Stigmata gelten kann. Wir, Normalen verhalten uns so, als ob stigmatisierte Personen nicht ganz menschlich sein und üben eine Vielzahl von Diskriminierungen aus. Dadurch werden die Lebenschancen der „Stimatisierten“ stark beeinträchtigt, wenn nicht überhaupt in Frage gestellt. Zumindest sind Diskussionen darüber, was als lebenswertes Leben angesehen wird und was nicht, in der breiten Öffentlichkeit oft erschreckend. Da dieses lineare Denken letzten Endes für uns alle bedrohlich werden kann, ist es unbedingt und gerade für uns als Pädagogen notwendig, uns für ein vernetztes Denken einzusetzen, wie es etwa von Lüpke und Voß (1994) oder Merz (1994) vertreten wird. Feuser schreibt zur Funktion der Attraktoren: Attraktoren sind jene Momente, durch deren Kenntnis uns die beobachtbare entwicklungsmäßige Drift eines Systems in seiner Entwicklung ‚Sinn‘ macht. Da wir als Pädagogen aufgerufen sind, nicht nur Lerninhalte zu vermitteln, sondern auch eine Umgebung zu schaffen, in der Kinder lernen können, müssen wir zum einen Faktoren erkennen, die lernhemmend sind, und zum anderen Voraussetzungen schaffen, die die Lernbereitschaft Rüderen (das gilt natürlich für alle Altersgruppen). Das folgende Beispiel eines Kindes mit Trisonomie 21 scheint mir die Funktion von Attraktoren gut zu erklären: „So z.B. daß es in Richtung eines uns depressiv-antriebsarm und interesselos erscheinenden, stereotyp handelnden Kindes tendiert – oder: unter vergleichbaren Ausgangsbedingungen aber mit Anfangsbedingungen sehr wohl gelingender früher Beziehungs- und Bindungsprozesse und den Randbedingungen einer integrativen Erziehung und Bildung zu einem lebendigen, neugierigen, aktiv handelnden und Problemen konstruktiv gegenübertretenden Kind. Im ersten Fall könnte, was wir mit ‚Isolation‘ beschreiben, Attraktoren ausmachen, im zweiten Fall die höhere Komplexität der Lernfelder und Interaktionspartner in diesen.“ (Feuser in Merz, S. 124)
Unsere Aufgabe liegt darin dem Kind eine verläßliche Umgebung zu schaffen, in der es sich selber Möglichkeiten entwickeln kann. Der Austauschprozeß zwischen zwei Menschen in Form des Dialogs, der Kommunikation und Interaktion wirkt demnach strukturbildend.
Menschen die auf ihrer biologischen-, psychischen- oder sozialen Entwicklungslinie ein einschneidendes Erlebnis haben, können gewissermaßen ins Chaos stürzen (z. B. Trennungserlebnis etc.). Da jedoch der Sinn des Lebens offensichtlich darin liegt, erhalten zu werden, organisiert es sich stets neu. Feuser stellt fest: „[…] daß in der üblichen Betrachtung eines als behindert oder psychisch krank geltenden Menschen, vor allem unter dem Dogma seiner Defektivität, auch diese Attraktoren-Funktionen nicht berücksichtigt werden.“ Feuser arbeitet u. a. mit komatösen Patienten. In einer solch extremen Situation können Unfallschock, Existenzangst, psychische Not, fremde Umgebung zu lebensgefährdenden Attraktoren werden. Allerdings kann durch das Schaffen eines vertrauten Klimas, den Besuch engster Vertrauter, das Lieblingsparfüm, die Kontaktaufnahme u.a.m. wieder ein Attraktor eingebracht werden, der zu einem Gleichgewichtszustand führen kann.
Bei einem System, das in „Unordnung“ geraten ist, versuchen Attraktoren und Operatoren das System neu zu strukturieren und zu ordnen. Auch, wenn wir es nach außen hin nicht sehen können, finden im System selber jederzeit viele Versuche der Neu-Strukturierung statt.
„Offene, sich mit der Umwelt austauschende Systeme, bringen nach einem Symmetriebruch Strukturen hervor, die in Phasenräumen physikalisch zyklischen, chemisch zyklisch-periodischen Prozessen (chemische Uhren) und biologisch (in geraden und ungeraden Phasen schwingenden) oszillierenden Prozessen entsprechen. Solche „dissipativen Strukturen“ organisieren sich fern vom Gleichgewicht selbst und halten sich fern vom Gleichgewicht durch periodische Oszillation um einen stationären Zustand – Grenzzyklus – stabil, indem sie sich durch Erfahrungsbildung ins System-Gedächtnis stets selbst neu hervorbringen.“ (Feuser, SS 1996).
Der Reduktionismus ordnet der Wirklichkeit Zahlen zu. Bei dieser Quantifizierung der Wirklichkeit lassen sich Teile zusammenzählen und von einander abziehen. Der Glaube an den Reduktionismus blüht bis in die heutige Zeit.
Die Wissenschaftler, die komplexe Systeme studieren, können mit dieser quantitativen Art des Messens nichts anfangen. Deshalb haben sich Wissenschaftler, die solche dynamischen Systeme untersuchen wollen, anderen Messverfahren zugewandt, nämlich qualitativen. In der alten quantitativen Mathematik konzentriert sich die messende Beschreibung eines Systems darauf darzustellen, wie die Maßzahl eines Systemteils die Maßzahl der anderen Teile beeinflußt. Dagegen will man durch die qualitative Beschreibung die Gestalt der Systembewegung als Ganzes darstellen. In dieser qualitativen Betrachtungsweise fragen Wissenschaftler nicht: wie stark beeinflusst dieser Teil jenen Teil? Sie fragen vielmehr: Wie erscheint das Ganze in seinen Bewegungen und seinem Wandel? Wie kann man ein ganzes System mit einem anderen vergleichen?
Der französische Mathematiker René Thom benutzte eine Art topologischer Faltung, um die nichtlinearen Änderungen zu beschreiben, bei denen Systeme abrupt und unstetig von einem Zustand in einen anderen übergeben. Thom untersuchte die äußeren Einwirkungen von Kräften auf Systeme die eine plötzliche Änderung bewirken. Sie stellt die Möglichkeit der qualitativen Messung dar. Insgesamt fasst er das Ganze in sieben sogenannte Elementarkatastrophen zusammen.
Im Folgenden werden beispielhaft zwei angeführt.
1. Falte:

Abb. 5: Thom‘ s Katastrophenfalte (BriggslPeat, S 121)
Als Beispiel dient ein Luftballon. Durch einen sich ändernden Luftdruck wird ein Luftballon aufgeblasen. Je nach dem, ob man den Druck erhöht oder erniedrigt, ändert sich der Zustand des Systems. Bei wachsendem Luftdruck wird der Ballon größer und größer, er bläht sich immer mehr auf Überschreitet man einen bestimmten Punkt zerplatzt der Ballon und es gibt ihn nicht mehr. Das System gibt es nicht mehr. „Wann immer ein System durch eine einzige Kontrollvariable (hier: Luftdruck) beherrscht wird, läßt es sich auf dieser topologischen ‚Landkarte‘ abbilden.“ (Briggs & Peat, S. 120) Praktische Verwendung findet dieses Verfahren z. B. wenn das Durchbrechen der Schallmauer durch ein Flugzeug dargestellt werden soll.
2. Art: Kuspen-Katastrophe
Thoms Kuspenkatastrophe hat auch Bedeutung für die Pädagogik. Anhand des folgenden Beispiels können wir ersehen, daß kleine Veränderungen im Verhalten oft nach außen nicht sichtbar werden, daß sie aber an einem kritischen Punkt zu einer abrupten Verhaltensveränderung führen können.

Abb. 6: Der innere Zustand eines Hundes beim Übergang von Wut in Angst (Briggs/Peat, S. 122)
Abb. 6 illustriert Thoms „Kuspen-Katastrophe“, die den inneren Zustand eines Hundes beim Übergang von Wut in Angst wiedergibt. Als Kontrollvariablen gelten hier Wut und Angst. Durch die Kuspen-Katastrophe kann man darstellen, wie Wut und Angst dazu führen können, daß das Verhalten eines Hundes plötzlich kippt. Betrachtet man einen Hund. Es nähert sich ein anderer Hund. Zunächst beginnt unser Hund sein Territorium, zu schützen indem er bellt und knurrt. In der unten angeführten Abbildung ist dieser Zustand rechst oben. Sollte nun der fremde Hund jedoch viel größer oder irgend wie bedrohlicher wirken, beschleicht vielleicht unseren Hund allmählich die Angst, und sein Verhalten beginnt sich zu ändern. Auf der Abbildung wandert der Zustandspunkt nach links. Noch befindet er sich allerdings im oberen Bereich der Katastrophenfalte, also in dem Bereich, der aggressives Verhalten bedeutet. Nach außen hat sich also noch nichts geändert, der Hund bellt weiterhin und zeigt die Zähne. Steigert sich aber die Angst unseres Hundes, so nähert sich der Punkt seines Verhaltens immer mehr der Katastrophenfalte, obwohl er noch immer bellt. Schließlich jedoch erreicht er die Kante der Falte selbst. Hier könnte ihn die kleinste Veränderung in einer der Kontrollvariablen (Wut oder Angst) über die Kante hinaustragen. Dabei würde dann unser Hund in einen völlig anderen Verhaltensbereich fallen. Er würde von jeder Drohgebärde ablassen und sich evtl. zur Flucht entscheiden.
Thoms Katastrophentheorem beweist: „Immer wenn sich ein System durch eine einzige Zustandvariable beschreiben läßt, die von zwei Kontrollvariablen beeinflußt wird, so läßt es sich durch die ‚Kuspen-Katastrophe‘ aus unten angeführter Abbildung darstellen. Diese Katastrophenfalte dient auch zur Beschreibung manisch-depressiver Anfälle, des Brechens der Meereswellen oder eines Aufruhrs im Gefängnis, … oder für Entscheidungsprozesse. Die nichtlinearen Systeme, die von Thoms Katastrophentheorie beschrieben werden, sind für den größten Teil des Lebens stabil. Nur wenn sie sich an den Rand einer jener Katastrophenfalten vorwagen, erleiden sie sprunghafte Veränderungen. Auch die Anziehungspunkte und Grenzzyklen, die wir früher betrachteten, lassen sich in Thoms Katastrophentheorie einordnen, doch sind sie nun auf einem topologisch deformierbaren Phasenraum einzuzeichnen.“ (Briggs & Peat, S. 122)
„Nichtlineare Systeme, seien sie nun chaotisch oder stabil, sie sind so komplex, daß sie nicht im Detail vorhersagbar und nicht in ihre Teile zerlegbar sind – die kleinste Störung schon kann explosiven Wandel auslösen.“ (Briggs & Peat, S. 123) Dies sind nur zwei Möglichkeiten der qualitativen Messung.
In der Literatur wird ein Mann oft erwähnt auf den die Erfindung einer neuen Geometrie zurückgeht: Benoit Mandelbrot. Er fand mit dem Fraktal eine besondere geometrische Figur, deren Form sich in immer kleinerem Maßstab wiederholt, wenn man näher an sie herangeht. Fraktal: „Dieses künstliche Wort ist vom latainischen ‚frangerre‘ abgeleitet, das ‚brechen‘ bedeutet. Auch die Anklänge an ‚gebrochene‘ Zahlen und an die Unregelmäßigkeit von ‚Fragmenten‘ bestimmten Mandebrots Wortwahl.“ (Briggs & Peat, S. 129) Ganze Zahlen sind: 0, 1, 2, 3 usw., gebrochene oder fraktale Dimensionen liegen dazwischen: 1,53824…
Mit der fraktalen Geometrie versuchen Mathematiker das Verhalten von komplexen Systemen in Bildern darzustellen. Ähnliche Figuren dieser Art waren schon früher bekannt: Kochs Schneeflockenkurve, der Caontor-Staub und der Sierbinski-Würfel.
„Fraktale werden nach einer einfachen Vorschrift erzeugt. Jeder Linienabschnitt der Figur wird durch ein komplizierteres Teilstück ersetzt, das aus mehreren kleinen Linienabschnitten besteht. Wenn man diesen Prozeß unendlich oft wiederholt, entsteht eine fraktale Figur, die sich selbst ähnelt, d.h. ihr Aussehen bleibt, unabhängig vom Grad der Vergrößerung, immer gleich.“ (Raven, S. 66) Eines der wohl beeindruckensten Bilder ist die Mandelbrotmenge oder das Apfelmännchen.

Abb. 7: Mandelbrot – Menge (Gleick, S. 317)
„Die fraktale Geometrie sollte man als eine neue mathematische Möglichkeit sehen, so wie eine neu gelernte Sprache, die es einem erlaubt, in bisher Unverständliches einzudringen und es beschreibbar zu machen.“ (Toifl, S. 62)
Das Apfelmännchen wurde zum Symbol für Chaos. Es zeigt eine unendliche Komplexität und ist das Ergebnis eines unendlichen Zahlenuniversums. Dieses wunderbare Gebilde ist der Grenzgänger einer neuen Geometrie. Otto Peitgen von der Universität Bremen meint: „Mandelbrot zeigte uns die richtigen Formen, um die Natur zu beschreiben.“ (Dokumentation, ORF)
Ein Fraktal ist eine geometrische Figur, die eine sehr spezielle Eigenschaft hat. Auch wenn man sie immer näher und näher betrachtet, sieht man im Wesentlichen immer dasselbe. Betrachtet man eine gerade Linie immer näher, so bleibt sie auch eine gerade Linie. Anders ist dies bei einem Kreis. Betrachtet man ihn näher, so wird er zur geraden Linie. Mandelbrot meint, es gäbe zwei geometrische Arten, die eine Unveränderlichkeit aufweisen. Zum einen gerade Linien und einige andere Linien, die wie Küstenlinien sind. Betrachten wir eine Küste immer näher und näher, so haben wir das Gefühl, wir sehen sie besser. Aber im Prinzip sieht sie immer gleich aus. Fraktale sind also Figuren, die diese Eigenschaft haben und doch keine Linien sind. Im Computer kann man künstliche Küstenlinien durch einfache Gleichungen schaffen. Das gelingt dadurch, daß man die Gleichung immer und immer wieder iteriert. (Siehe Kapitel Iteration) Betrachtet man sie nun durch das „Computermikroskop“ und versucht, diesen künstlichen Küstenlinien näher und näher zu kommen, so sieht man immer den selben identischen Kräuselungsgrad. Viele natürliche Objekte sind solche Fraktale: z. B. Schneeflocken. Jede sieht anders aus und doch befolgen sie alle dieselben Schneeflockenregeln.

Abb. 8: Die ersten Stufen zur Konstruktion der Koch-Schneeflockenkurve (Jürgens/Peitgen/Saupe, S. 115)
Mandelbrot spricht von einer „Selbstähnlichkeit“ auf einer immer kleineren Skala. Ähnlich ist auch das Beispiel der russischen Puppen. Eine große Puppe enthält in sich immer eine kleinere, sie sehen im Prinzip jedoch alle gleich aus. „Es wurde immer klarer, daß Selbstähnlichkeit nicht etwa nur irgendeine uninterssante Eigenschaft ist, sondern ein mächtiges Mittel zum Hervorbringen von Gestalt. Die komplexen Systeme der Natur behalten anscheinend ihr Aussehen im Detail auf immer kleineren Skalen bei.“ (Briggs & Peat, S.130)
Praktische Verwendung findet diese Geometrie für die Beschreibung von sehr unterschiedlichen komplexen Systemen, wie Wolken, Gebirge, Blutgefäße usw.
Eine andere interessante Variante zeigt sich, wenn man versucht, die Länge einer Küste zu messen. Je nachdem welchen Maßstab wir benutzen und wie genau wir sie betrachten, kann sie unendlich lang werden. Wir können immer mehr Detail erfassen Felsen, Steine, Kiesel, Staub bis hin zu Molekülen. Durch die Art unserer Betrachtung kann jede Küstenlinie unendlich lang werden. Das können wir aber auch mit jeder anderen Figur machen. Sie kann dann auch einen unendlich langen Rand bekommen.
„Mandelbrot ging deshalb so weit zu sagen: Wenn diese fraktale Geometrie auf eine unentwirrbare Beziehung zwischen dem Beobachter und seinem Beobachtungsgegenstand hinweist, so paßt das sehr gut zu den anderen Entdeckungen unseres Jahrhunderts, Relativität und Quantentheorie, wo ja ebenfalls eine enge Abhängigkeit zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten gefunden wurde.“ (Briggs & Peat, S. 137)
Überall also unterwandern Benoit Mandelbrots Fraktale unsere Wahrnehmung der Welt: in der Physik, Biologie, Geographie, Astronomie etc. Vom Dahinschlängeln der Flüsse zu den Windungen menschlicher Gehirne, bei den Verzweigungen an einem lebenden Baum, Blumenkohl und Brokkoli: Äste haben Zweige, diese haben wieder kleinere Zweige, und die Details wiederholen sich bis hinunter zur Größe der kleinsten Zweiglein.
Die Evolution komplexer Systeme läßt sich nicht im Detail verfolgen, solche Systeme sind als ganzheitlich zu betrachten: alles beeinflußt ständig alles. Um sie zu verstehen, muß man in ihre Komplexität hineinschauen.
Die fraktale Geometrie sorgt reichlich für diese Anschauung: ein Abbild der Qualitäten des Wandels.

Abb. 9: Die Entstehung eines Farns im Computer
Zu Beginn versuche ich mit einer Geschichte aufzuzeigen, wie sich der mögliche Ursprung attraktorartiger Eigenwelten darstellen kann, wie sie Ciompi in seiner „fraktalen Affektlogik“ beschreibt. (Ciompi, 1997)
„Es war einmal ein Mann, der hatte seine Axt verloren. Er hatte seines Nachbars Sohn in Verdacht und beobachtete ihn. Die Art, wie er ging, war ganz die eines Axtdiebes; sein Gesichtsausdruck war ganz der eines Axtdiebes; aus allen seinen Bewegungen und aus seinem ganzen Wesen sprach deutlich der Axtdieb. Zufällig grub der Mann einen Graben um und fand seine Axt. Am anderen Tag sah er seinen Nachbarssohn wieder. Alle seinen Bewegungen und sein ganzes Wesen hatten nichts mehr von einem Axtdieb an sich.“ Diese Geschichte geht auf LIÄ DSI einen chinesischen Weisen zurück.
Mit dem Konzept der fraktalen Affektlogik untersucht Ciompi die Wirkung von Affekten auf die Kognitionen, wobei er sich auf chaostheoretische Konzepte bezieht. Er zeigt, wie es unter der Wirkung von spezifischen Kontroll- und Ordnungsprametern innerhalb von psychischen und psychosozialen Systemen, zu plötzlichen nichtlinearen Phasensprüngen – zu einem `Überschnappen‘ oder ‚Verrücken‘, zu andersartigen Fühl-, Denk- und Verhaltensmustern kommen kann. Affekte sind die entscheidenden Energieträger im Bereich der Psyche. „Unter Anwendung von chaostheoretischen Erkenntnissen wird es auf dieser Basis möglich, die genannten globalen Fühl-, Denk- und Verhaltensweisen als umfassende Energieverteilungsmuster (spezifische affektenergetische Besetzungen des operationalen kognitiven Feldes) oder `dissipative Strukturen‘ im Sinne von PRIGOGINE zu verstehen.“ (Ciompi, S. 170) Es gibt fünf Affektzustände die unsere Fühl-, Denk- und Verhaltensdynamik wesentlich bestimmen: die Alltagslogik, Angstlogik, Wutlogik, Trauerlogik, Freudelogik. Ciompi gibt Einsicht sowohl in die deterministisch-chaotische Attraktorwirkungen von spezifischen affektiven Zuständen, wie auch in eine typische Fraktalstruktur von psychischen Prozessen aller Art. Mit seiner Hypothese bringt er sowohl affektive und kognitive Komponenten der Psyche, als auch innerpsychische, soziale und biologische Phänomene mit dem Konzept der strukturellen Koppelung in einen Gesamtzusammenhang. (vgl. Ciompi, S 170ff)
Ciompi postuliert durchgehende Fraktalstruktur von psychischen Erscheinungen über verschiedene Dimensionen der Psyche. Fraktalität bedeutet, Selbstähnlichkeit im kleinsten wie im größten. Sie liegt dann vor, wenn bei einem bestimmten Phänomen gleiche Strukturen über mehrere hierarchische Ebenen hinweg nachgewiesen werden können.
Ciompi zählt folgende fünf Anhaltspunkte für eine Fraktalstruktur im psychischen Bereich auf (Ciompi, S. 163f)
- „Hierarchisch unter- wie übergeordnete Fühl-, Denk- und Verhaltensprogramme – oder ‚Bausteine der Psyche‘ – unterschiedlichster Größenordnung enthalten obligat affektive Komponenten, die mit kognitiven Elementen funktionell verbunden sind. Diese Affekte üben überall gleichartige allgemeine und spezifische Operatorwirkungen auf die kognitiven Elemente aus. Dies begründet skalenunabhängig selbstähnliche affektiv-kognitive Dynamismen sowohl innerhalb von elementaren, wie von hochdifferenzierten Fühl-, Denk- und Verhaltensprogrammen.
- Unter dem Einfluß derselben Operatorwirkungen der Affekte sind selbstähnliche affektiv-kognitive Dynamismen in ganz kurzfristigen, wie auch lang- und längerfristigen Sequenzen – das heißt, auf allen nur möglichen zeitlichen Ebenen – zu beobachten.
- Analoge Operatorwirkungen der Affekte auf das Denken sind ferner auf der individuell-innerpsychischen, auf der mikrosozialen (z.B. intrafamiliären) und auf der makrosozialen (z. B. internationalen) Ebene am Werk.
- Umgekehrt läßt sich jede Fühl-, Denk- und Verhaltenstrajektorie auf übergeordneter (z. B. makrosozialer) Ebene in eine beliebige Zahl von selbstähnlichen Trajektorien auf unteren (z. B. mikrosozialen oder individuellen) Ebenen auflösen.
- Selbstähnliche affektiv-kognitive Dynamismen sind ebenfalls auf der biologischen, psychologischen und sozialen Ebene zu vermuten.“
Diese Punkte werden im Folgenden genauer begründet:
Affekte haben grundsätzlich eine Operatorwirkung auf das Denken sowohl innerhalb von kleinsten als auch größten affektiv-kognitiven Bezugssystemen. Die verschiedenen Grundgefühle Wut, Interesse, Angst, Trauer oder Freude selektionieren und mobilisieren zum Beispiel ganz gleich, ob es im Rahmen eines Streits um ein Spielzeug im Kindergarten geht, oder um einen Ehestreit, oder eine politische Auseinandersetzung auf allen Ebenen prinzipiell durchaus in gleichartiger Weise diesbezügliche Denkinhalte und Verhaltensprogramme. Die Aufmerksamkeit wird fokussiert und hierarchisiert nach ähnlichen früheren Erinnerungen und es entsteht eine bestimmte Denklogik, ausgehend von verdrängtem bis zu gegenwärtigem Bewußtsein. Angst übt zum Beispiel auf allen hierarchischen Stufen die gleiche aversive Wirkung auf ein kognitives Objekt aus, an das sie gebunden ist, egal wie komplex dieses Objekt ist (einen bestimmten Ort, eine umschriebene Situation, eine bestimmte Person, aber auch auf hochkomplexe kognitive Inhalte wie ein ganzes Land, eine Religion oder eine politische Ideologie).
Die Selbstähnlichkeit von affektiv-kognitiven Prozessen gilt über alle zeitlichen Dimensionen hinweg: Im Rahmen einer kleinen momentanen Gedankenkette, ebenso wie sie über Monate oder Jahre hinweg das Leben bestimmt. Es ist eine Gedankenwelt von immer gleicher Affekttönung. Ängste und Sorgen werden sowohl momentan als auch langfristig die Aufmerksamkeit selektiv auf angstbesetzte und potentiell gefährliche kognitive Inhalte lenken und diese zu einer entsprechend eingefärbten umfassenden „Angstlogik“ verbinden. Kurz- oder langfristig werden ganze Denk- und Verhaltenshierarchien affektentsprechend organisiert werden, wie uns die oben angeführte Geschichte des Axtdiebes zeigt.
Kommunikations- und Informationsverarbeitungsmuster haben ebenfalls eine Fraktalstruktur aufzuweisen. Es spielen sich kaum bewußte Feinwahrnehmungen und Sympathien oder Antipathien bei einer erstmaligen Begegnung zwischen zwei oder mehr Personen oft blitzschnell bestimmte Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen ein, die in der Folge das ganze weitere Verhältnis zwischen den betreffenden Partnern dauerhaft bestimmen. Ciompi schreibt, daß wir selbst sogar unsere langfristigen Überzeugungen und daraus resultierenden Verhaltensweisen oft aus sogenannten Ad-hoc-Informationen aufbauen, die wir nur flüchtig beim Zeitungslesen oder Fernsehen kaum bewußt aufnehmen. Diese Muster verfestigen sich mit der Zeit zu richtigen „Fühl- Denk- und Verhaltensschienen“, die zu festen Persönlichkeitszügen werden. Gute Psychologen sind in der Lage, langfristig wirksame Persönlichkeitsmerkmale bereits aus kleinsten Äußerungen zu erschließen. Es kann dabei im Extremfall eine Geste oder ein Wort genügen. Ciompi ordnet die Persönlichkeitstests ebenfalls dieser Fraktalhypothese zu. Der persönliche Lebensstil und die gesamte Organisation kann als große Fraktale Gestalt gesehen werden. Das große Ganze kann schon im kleinsten und einzelnen angelegt und dem Kundigen auch durchaus erkennbar sein. (vgl. Ciompi, S. 165f)
Affektiv-kognitive Dynamismen laufen auf individuellem, mikrosozialem und makrosozialem Nieveau selbstähnlich ab. Auf der individuellen Ebene kann zum Beispiel ein Anfall von Jähzorn ganz gleich organisiert sein, wie auf der kollektiven Ebene ein Volkszorn. Ciompi erwähnt den politischen Konflikt zwischen Juden und Arabern. „In jeder zeitlichen wie räumlichen Dimension sind es wiederum die gleichen emotionalen Operatorwirkungen, die selektive kognitive Inhalte zu übergeordneten kognitiven Gestalten – etwa zur Geschichte einer glücklichen oder unglücklichen Beziehung oder zur Geschichte aller je erlebten angst-, wut-, trauer-, ruhm- oder schmachvollen Ereignissen – verleimen, die sie dann als Ganzes in der Erinnerung abspeichern und von dort auch je nach der (momentanen oder zeitüberdauernden) affektiven Gestimmtheit immer wieder affektgeleitet hervorholen – oder im Gegenteil verdrängen, verneinen, abspalten, projizieren.“ (Ciompi, S. 166)
Jede einzelne Fühl-, Denk- und Verhaltenstrajektorie läßt sich auf jedem Niveau in eine beliebige Zahl von selbstähnlichen Untertrajektorien auflösen. So läßt die tragische Tatsache, daß ein Lehrer einem Schüler in einem bestimmten Moment eine Ohrfeige gibt, eine fast endlose Komplexität des Verhaltens finden. Will man die Hintergründe einer solchen Handlung ergründen, zeigen sich immer neue fraktale Perspektiven. Psychoanalytisch gesehen können die Wurzeln in der persönlichen Geschichte von Lehrer wie Schüler und deren multiplen übertragungs- und gegenübertragungsmäßigen Ausläufern gefunden werden. „Typische Übetragungsphänomene (also in der Kindheit konditionierte typische Reaktionsweisen gegenüber Elternfiguren) sind prinzipiell selbstähnlich und skalenunabhängig konfiguriert. – Die ganze Erscheinung stellten damit ein fraktales Phänomen par excellence dar“ (Ciompi, S. 167) Neben dem psychoanalytischen wären aber auch noch zahlreiche andere Zugänge zu einem bestimmten Ereignis möglich: systemische, lerntheoretische, soziodynamische u.a.m. Außerdem können noch historisch-kulturelle Mikro- und Makrosituationen von Lehrer und Schüler miteinbezogen werden. Die Komplexität eines bestimmten Phänomens kann somit ins Uferlose wachsen.
Eine Fraktalbeziehung gibt es auch zwischen den wechselseitig strukturell gekoppelten Bereichen des innerpsychischen, sozialen und biologischen Geschehens. Das Konzept der strukturellen Koppelung weist auf eine gegenseitige strukturelle Angleichung von grundlegenden Mechanismen und Organisationsformen hin, die über Systemgrenzen hinweg eine gewisse Selbstähnlichkeit aufweisen. „Wir dürfen annehmen, daß auf allen drei Ebenen grundsätzlich ähnliche affektiv-kognitive Dynamismen ablaufen: Während es auf der psychologischen und sozialen Ebene individuelle oder kollketive psychische Gestimmtheiten sind, die das Denken kanalisieren und regulieren, sind es auf der biologischen Ebene die biochemischen Äquivalente solcher Stimmungen oder Grundbefindlichkeiten, die die kognitiven Funktionen in analoger Weise beeinflussen.“ (Ciompi, S. 168) Diese drei Bereiche weisen jedoch unterschiedliche Qualitäten und Dimensionen auf „Biologische Prozesse spielen sich auf mikroneuronal biochemisch-bioelektrischem Niveau ab, psychologische Prozesse dagegen laufen auf der Ebene des individuellen Bewußtseins, während soziale Prozesse innerhalb von Entitäten vor sich gehen, die von Familien und kleinen Gruppen bis zu ganzen Völkern reichen.“ (Ciompi, S. 168)
Ciompi zeigt deutlich auf, wie Alltagslogik, Angstlogik, Wutlogik, Trauerlogik und Freudelogik als typische Attraktoren von deterministisch-chaotischen Strukturen wirken. Der Umstand, daß in jedem spezifischen Affektzustand einerseits die ganze Fühl-, Denk- und Verhaltensdynamik im großen innerhalb eines durch die jeweilige Stimmung vorgegebenen Rahmens abläuft, im einzelnen aber hochsenisitv für Umweltreize unvorhersehbar variiert, deutet klar auf selbstähnliche iterative Prozesse hin. Auf die Bedeutung der Iteration für komplexe dynamische Systeme gehe ich im folgenden Kapitel ein.
„lteration – Rückkoppelung durch stetige Wiederaufnahmen und Wiedereinbeziehung von allem, was vorher war – begegnet uns fast überall: In sich dahinwälzenden Wettersystemen, bei der künstlichen Intelligenz, in der periodischen Erneuerung unserer Körperzellen.“ (Briggs & Peat, S. 92)
Wie schon Edward Lorenz beim Wetter entdeckte, ist eine wesentliche Eigenschaft iterativer Gleichungen die Empfindlichkeit gegenüber den Anfangsbedingungen. Im 19. Jahrhundert hatten Wissenschaftler stets angenommen, daß ein kleiner Fehler in den Anfangsdaten entweder später ausgeglichen wird oder höchstens eine kleine Wirkung hervorbringen würde. Wenn es aber um Iteration geht, so können winzige Fahler rasch verstärkt werden. (vgl. Briggs & Peat, S. 99) Wissenschaftler glauben, daß sich aber nicht nur Zahlen so verhalten. Unser Altern kann man sich demnach als Prozeß vorstellen, in dem durch ständige Iteration unserer Zellen schließlich Knitterspuren und Abweichungen entstehen, die unsere Anfangsbedingungen sozusagen verderben und uns allmählich zerfallen lassen – wir werden dem Tod entgegengezogen durch den wohl letzten „seltsamen Attraktor“.
Einige Wissenschaftler meinen, die Ungewißheit oder Fehler, die Informationslücken in der Kenntnis der Anfangsbedingungen dynamischer Systeme, seien ähnlich den Keimen, aus denen Turbulenz und Chaos hervorgehen: der Schmetterlingsflügelschlag, der ein Erdbeben auslösen kann. Alles könnte zu einem solchen Keim werden, wenn es in der richtigen Dynamik an der richtigen Stelle ist. „Die Gestalt des Ganzen hängt vom winzigsten Teil ab. So gesehen ist der Teil das Ganze, denn durch das Wirken jedes Teiles kann sich das Ganze in Gestalt des Chaos oder des Wandels manifestieren. Dieser den Wandel bewirkende Teil, der Anfang des Ganzen, ist die Informationslücke, die im Laufe der Iteration die Unvorhersagbarkeit des Systems herausbildet. Die dabei hinterlassene Spur ist der seltsame Attraktor.“ (Briggs & Peat, S. 107)
Diese sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen spielt auch eine Rolle bei der Entstehung von Krankheiten. Basierend auf der Vorstellung, daß der Mensch erst durch die Integrierung sowohl seiner körperlichen, als auch seiner individuell psychischen und seiner sozialen Dimension als ganzer Mensch und damit als Einheit erfaßt werden kann, ergibt sich die Notwendigkeit Krankheit und Gesundheit neu zu definieren. (vgl. Toifl, S. 203ff) In diesem Menschenbild ist die untrennbare nichtlineare Verknüpfung dieser drei Ebenen (körperliche, psychische und soziale Ebene) anzunehmen. Aufgrund dieser nichtlinearen Wechselwirkungen kann im Detail nie gesagt werden, welche Entwicklungen das System Mensch nehmen wird.
Normalerweise bleibt ein System trotz geringfügiger Veränderungen stabil. Nur manchmal können geringfügige Veränderungen bewirken, daß an einem Bifurkationspunkt eine Verhaltensveränderung des Gesamtsystems auftritt.
Dadurch, daß ein System ständig externen und systeminternen Veränderungen ausgesetzt ist, und dadurch, daß man den momentanen Systemzustand nie exakt messen kann, können auch keine exakten Aussagen darüber gemacht werden, ab wann ein komplexes System Mensch als krank oder gesund zu bezeichnen ist.
„Demnach könnte man nicht genau sagen, wann der jetzt eindeutig kranke Systemzustand, etwa der Leber, aus einem noch gesunden Zustand in einen bereits kranken Systemzustand kippte, da ja das hochdiffizile nichtlineare Zusammenspiel der einzelnen Subsystemebenen der Leber und die iterative Wechselwirkung mit den anderen Organsystemen sowie den psychischen und sozialen Bereichen eine detaillierte Aussage unmöglich macht.“ (Toifl, S 204)
Man könnte davon ausgehen, daß ein Mensch mit größerer Wahrscheinlichkeit in einer oder allen drei Dimensionen seines System-Zustandes im Bereich des „Krank-Seins“ befindet, wenn seine strategischen Möglichkeiten der Problemlösung nicht ausreichen. Andererseits würde es bedeuten, daß sich ein Mensch mit größerer Wahrscheinlichkeit auf allen Ebenen im Bereich „Gesund-Sein“ befindet, sobald er seine Problemlösungsstrategien dahingehend ändert, daß sie möglichst flexibel und zielführend sind.
Die Wahrscheinlichkeit von „Krank-Sein“ und „Gesund-Sein“ hängt jedoch nicht nur von den Problemlösungsstrategien des einzelnen, sondern auch vom Schweregrad der Anforderungen, die an das System von außen gestellt werden.
Aristoteles formulierte folgendes bereits im vierten Jahrhundert v. Chr. in seiner Nikomachischen Ethik: Es zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit zufriedenzugeben, den die Natur der Dinge zuläßt, und nicht dort Exaktheit zu suchen, wo nur Annäherung möglich ist. (Briggs & Pest, S.109)
Nachdem wir nie mit Sicherheit wissen, was in einem nichtlinearen dynamischen System gerade geschieht, wissen wir auch nicht, wo durch Iteration und Rückkoppelung jener Punkt erreicht wird, an dem ein System vom Zustand „gesund“ in den Zustand „krank“ kippt. Diese Erkenntnis hat eine grundlegende Bedeutung für sonderpädagogisches Handeln.
Die Frage der Diagnostik spielt in der Sonderpädagogik eine große Rolle. Kinder werden üblicherweise nach herkömmlichen Testverfahren eingestuft. Diese Tests entscheiden meist darüber, ob ein Kind das Etikett „behindert“ erhält und damit in eine Sonderschule zugewiesen wird oder in der Regelschule verbleiben kann. Diese Art der Diagnostik trägt dazu bei, daß Kinder an ihrem Versagen beurteilt werden. Die Aufmerksamkeit des Beobachters ist auf die Störung, das Defizit oder die Krankheit des jeweiligen Kindes konzentriert und fixiert. Jede Lernbehinderung wird als normabweichende Verhaltens- und Leistungsform ausgewiesen. Das Ziel liegt in einer Aussonderung der betreffenden Kinder und kann als „Selektionsdiagnostik“ bezeichnet werden. In der Sonderpädagogik sind vorwiegend Meßinstrumente entwickelt worden, die individuelle Merkmale wie Intelligenz und Schulleistung erfassen, die Ursache des Versagens wird im Individuum selber gesucht. „Die traditionelle sonderpädagogische Diagnostik interpretiert Schulversagen damit einseitig als ein Versagen des Schülers. Auf dieser Grundlage dient sie als Rechtfertigungsinstrument für Selektionsentscheidungen.“ (Eberwein in von Lüpke/-Voß, S. 143) Die pädagogisch-psychologische Diagnostik hat sich an naturwissenschaftlichen Experimenten orientiert und die soziale Bedeutung sowie die interaktionisitische Dimension von Lernsituationen kaum berücksichtigt.
In der sonderpädagogischen Diagnostik hat sich in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel vollzogen. Im Vordergrund steht die Forderung nach Chancengleichheit in einer humanen Schule und auch die Forderung nach gemeinsamem Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten. Diagnostisches Handeln wird als ganzheitliche und entwicklungsorientierte Betrachtensweise gesehen. Der Begriff „Förderdiagnostik“ rückt die gesamte Lern- und Lebenssituation des betroffenen Schülers in den Mittelpunkt. Pädagogische Prozesse müssen immer als komplexe Lehr- und Lernprozesse gesehen werden. „Pädagogische Diagnostik berücksichtigt die Biographie und den Sozialisationshintergrund des Schülers ebenso wie sein Lernverhalten, individuelle Lernstrategien, emotionale und soziale Gesichtspunkte. Sie geht generell vom Lernwillen und von Förderbedürfnissen bei Schülern aus.“ (Eberwein in von Lüpke/Voß, S. 142) Die jeweiligen Fähigkeiten des Schülers bilden die Ansatzpunkte für die individuellen Fördermaßnahmen.
Die Förderdiagnostik geht prinzipiell von folgenden Prämissen aus:
- Die menschliche Entwicklung wird, […] neben biologischen auch durch soziale Faktoren, durch verschiedene Ökosysteme u.a. bestimmt. Beide Wirkungsgrößen beeinflussen sich wechselseitig; sie stehen in einer interaktiven Beziehung. Innerhalb dieses Prozesses ist das Kind aktiv an seiner Entwicklung beteiligt. Diese dynamische Sichtweise ist in der bisherigen sonderpädagogischen Diagnostik vernachlässigt. worden.
- Entwicklungspsychologisch und lerntheroretisch gesehen gibt es keinen globalen Mangel an Lernfähigkeit im Sinne einer generellen Lernbehinderung, sondern nur aufgabenspezifische Schwierigkeiten. Lernprobleme sind mit der Entwicklung und dem Lernen inhärent gegeben; sie haben daher Allgemeinheitscharakter.
- Kinder lernen verschieden und Verschiedenes. Deshalb hat jedes Kind das Recht auf einen eigenen Lernweg. Schule muß demzufolge die verschiedenen Lernentwicklungen und Lernniveaus akzeptieren. Der `Normal‘-Schüler ist eine Fiktion, denn jedes Kind ist individuell spezifisch lernfähig.
- Für das schulische Lernen bedeutet das unter den ersten drei Punkten genannte Entwicklungskonzept die Anerkennung zieldifferenzierten Lernens. Dies verhindert Aussonderung und damit Diskriminierung sowie soziale Benachteiligung. Im Verständnis dieses Lernbegriffs macht die Zuschreibung von abweichendem Lern- und Sozialverhalten keinen Sinn mehr. Es geht vielmehr darum, durch intensive Verhaltensbeobachtung das Lernverhalten und sein Bedingungsgefüge zu erforschen. (Eberwein in von Lüpke/Voß S. 145)
„Die Beobachtung ist die wichtigste Form der Informationsgewinnung. Ihr kommt im Rahmen konventioneller pädagogischer-psychologischer Untersuchungen nur eine untergeordnete Rolle zu. Dementsprechend ist z. B. der Informationsgehalt sonderpädagogischer Gutachten gering. Dort findet man vorwiegend Angaben über äußere Verhaltensmerkmale von Schülern (beobachtet in Testsituationen), die keine Übertragung auf den schulischen Alltag erlauben.“ (Eberwein in von Lüpke/Voß, S. 145f) Menschliches Verhalten ist vor allem Dingen geprägt von äußern Bedingungen, von sozialen Beziehungen, Kommunikationsstrukturen und Situationsvariablen, wie Eberwein meint. ( vgl. Eberwein in von Lüpke/Voß, S. 146) Aus chaostheoretischer Sicht können wir nie die Anfangsbedingungen eines dynamischen Systems genau erfassen. Unsere Beobachtung sind immer nur Ausschnitte der Wirklichkeit und außerdem ist jede Wahrnehmung prinzipiell nur subjektive Wahrnehmung, d. h. wir sehen die Welt jeweils nur mit unseren eigenen Augen. Wir können deshalb ein Kind nie wirklich objektiv beurteilen. Alle verhaltensdiagnostischen Aussagen sind immer nur als vorläufig zu betrachten. Diagnosen können leicht zu Fehlurteilen werden. Fehler in der Erfassung der Anfangsbedingungen können sich durch Iteration und Rückkoppelungsprozesse so aufblähen, dass sie ein System ins Chaos stürzen. Grundsätzlich scheint mir bei der diagnostischen Beurteilung folgende wichtig zu sein: „Keine Einzelbeobachtung ist für sich allein genommen hinreichende Grundlage für Beurteilungen. Erst Ein sorgfältiges Gegeneinanderhalten der Einzelbefunde, ein Vergleich und Abwägen ihrer Gewichtigkeit, ein Prüfen vor allem der einander wiedersprechenden Aussagen, ein Tasten und Suchen nach dem ´ roten Faden `, der sich durch alle Einzelaussagen hindurchzieht geben eine ausreichende Basis für verwertbare Aussagen einer Persönlichkeit.“ (Eberwein in von Lüpke/Voß, S. 146) Es ist notwendig, dass wir als Eltern, Lehrer und Erzieher uns im ganzheitlichen Sinn auf unsere Kinder einlassen und mit ihnen ein Stück in ihrem Leben gemeinsam gehen. Dadurch können wir den Kindern die Chance einräumen, dass sie ihren eigenen aktiven Beitrag zu ihrer Entwicklung leisten können, und somit besteht auch im schwierigsten Fall die Möglichkeit zu einer dialogischen Entwicklung.
Der Physiker Michell Feigenbaum untersuchte Gleichungen mit Periodenverdopplungsverhalten. Er entdecke dabei 1976 mit dem Taschenrechner eine universelle Zahlenfolge für das Verhalten von diesen Gleichungen. Diese Zahlen wurden berühmt als Feigenbaum-Zahlen. Das Wesentliche dabei ist wohl, dass die Periodenverdopplungsverhalten ein gemeinsamer Zug ist beim Zusammenbrechen von Ordnung und beim Übergang ins Chaos. Er entdeckte, dass ein System das wieder und wieder auf sich selbst zurückwirkt, an genau diesen universellen Stellen der Skala Veränderungen erleiden wird. Er errechnete einige universelle Zahlen, die Verhältnisse auf der Skala der Übergangspunkte im Verdoppelungsprozeß darstellen.
Das Bifurkationsereignis, der Schritt durch eine chaotische Zone, wird dabei durch die sogenannte Feigenbaumzahl charakterisiert. Diese Zahl ist eine irrationale Zahl, das heißt ein Bruch, der auch bei noch so langem Verfolgen der Dezimalstellen weder aufgeht noch Perioden zeigt. Eine erstaunliche Entdeckung: Mathematiker und Physiker fanden bei der genauen Analyse einer Gleichung, die ursprünglich für rückgekoppelte biologische Systeme aufgestellt worden war, eine Universalkonstante, der die sprunghaften Übergänge in der gesamten Natur gehorchen, seien es Periodisierungen, Periodenverdoppelung oder Übergänge von Periodizität in Chaos. Daraus muß man schließen, daß Chaos eine regelhafte, in der Natur und ihrer Systematik vorgesehenen Zustandsform ist, daß also die Welt in ihrer Grundstruktur nichtlinear ist, daß sie aber aus dem deterministischen Chaos immer wieder Inseln der Ordnung hervorbringt, auf denen unsere einfachen linearen Gesetze angewendet werden können. Die Linearisierung, die wir im kartesianisch-newtonschen System notwendigerweise durchführen müssen, um überhaupt physikalische Gesetze hinschreiben zu können, ist daher insulär. Das zeigt sich besonders deutlich an den Rändern der Insel. (vgl. Cramer, S. 96)
Forscher in verschiedenen Disziplinen konnten mit diesen Zahlenwerten und den Erkenntnissen über Periodenverdoppelung Neues entdecken. Der Medizinphysiker Richard J. Cohen und seine Kollegen entdeckten bei Computersimulationen von Herzrhythmen, daß Periodenverdoppelung ein Schlüssel zum Verständnis von Herzanfällen ist. In einem normalen Herzen breiten sich die elektrischen Impulse gleichmäßig durch die Muskelfasern aus, durch die die Herzkammern sich zusammenziehen und das Blut pumpen. Im zusammengezogenen Zustand sind die Muskelfasern für elektrische Signale undurchlässig. Ärzte nennen diese Periode die „refraktäre Phase“. Nach der Theorie sind Unterschiede in der Dauer der refraktären Phase in verschiedenen Herzbereichen die Ursache für das Flimmern, die schnellen krampfhaften Zuckungen bei einem Herzanfall. Probleme tauchten auf, sobald ein Teil der Herzmuskelfasern refraktäre Phasen hatte, die länger waren als das Herzschlagintervall. Eben deshalb gerieten diese Herzfasern außer Takt und konnten nur bei jedem zweiten Herzschlag angeregt werden. Das hatte zur Folge, daß die elektrischen Impulse des sich zusammenziehenden Herzens sich an diesen zurückgebliebenen Fasern wie Wasser verhielt, das über einen Felsen schäumt und Turbulenz verursacht. Wenn man die refraktären Phasen einiger Fasern verlängert, so läßt sich das ganze Herz in ein Verhalten der Periodenverdoppelung versetzen, bis schließlich nach Erreichen eines kritischen Wertes der refraktären Phase vollständiges Herzmuskelchaos einsetzt.
Aber nicht nur in der Medizin wurde die Wirkung von Periodenverdoppelung entdeckt. Auch in chemischen Reaktionen oder beim Entstehen von Turbulenz. (Briggs & Peat, S. 88 ff)
Der Begriff Bifurkation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gabelung. 1m Falle der Flüsse ist die Furkation in den zahlreichen Nebenarmen und Seitengerinnen gut zu sehen.

Abb. 11: Schematische Darstellung eines Flusses im Längsverlauf (Studie 1989, S. 66)
Solche Verzweigungsstellen entscheiden über Ordnung und Chaos in einem System. llya Prigogine entwickelte ein Weltbild, in dem Bifurkation ein zentraler Begriff ist. „Eine Bifurkation ist in der Systementwicklung ein entscheidender Moment, in dem etwas so Winziges wie ein einzelnes Photon, eine kleine Schwankung der äußeren Temperatur, eine Dichteveränderung oder Flügelschlag eines Schmetterlings in Hong Kong durch Iteration so weit aufgebläht wird, daß eine Abzweigung vom Weg entsteht und das System in einer neuen Richtung davonläuft. Im Laufe der Zeit bringen ganze Kaskaden von Bifurkationsstellen ein System entweder dazu, sich entlang dem Periodenverdoppelungsweg ins Chaos zu zersplittern oder durch eine Reihe von Rückkoppelungsschleifen (wie Autokatalyse, gegenseitige Katalyse und Selbsthemmung), die die jüngsten Änderungen jeweils mit der Umgebung verknüpfen, ein neues Verhalten zu stabilisieren.“ (Briggs & Peat, S. 212)
Hat sich ein System nach Durchgang durch eine Bifurkation durch Rückkoppelung stabilisiert, so kann es unter Umständen für Millionen von Jahren allen weiteren Änderungen widerstehen, bis eine weitere kritische Störung die Rückkoppelung verstärkt und zu einem neuen Bifurkationspunkt führt.
An jeder Bifurkationsstelle in der Geschichte eines Systems gibt es für den Fluß der Zeit verschiedene Zukünfte. Iteration ermöglicht es, eine Zukunft auszuwählen. Alle anderen Möglichkeiten verschwinden an dieser Stelle für immer. Bifurkationspunkte stellen ein Abbild der Irreversibilität der Zeit dar. An ihnen wird unsere ganz individuelle Geschichte sichtbar. Allerdings ist nicht vorhersagbar, welchen Weg das System an einem solchen Punkt einschlagen wird.
Die Zeit läuft immer weiter, jedoch wird an den Bifurkationspunkten die Geschichte des Systems zeitlos aufbewahrt. Durch Rückkoppelung an diese Punkte wird der neue Weg stabilisiert. Die Dynamik der Bifurkation zeigt, daß die Zeit zwar irreversibel ist, aber doch stets die Vergangenheit rekapituliert.
An diesen Stellen wird sozusagen ein „Gedächtnis“ verankert. Das System bleibt sehr empfindlich für alle Arten von Informationen, die an solche früheren Bifurkationen erinnern. Nach dem Überschreiten eines Bifurkationspunktes kann sich ein neuer Systemzustand durch Rückkoppelung so weit stabilisieren und sich stabil halten, daß er sogar über Jahrmillionen besteht, wie aus der Evolution ersichtlich ist.
Die Kreativität eines Systems liegt in seiner Flexibilität. Zu jeder Verzweigungsstelle gehört die Verstärkung von etwas winzig Kleinem. Iteration gibt den Anstoß, damit ein System an einem bestimmten Punkt seinen bisher gewohnten Weg verläßt. So gesehen ist die Fähigkeit des Systems eine kleine Schwankung zu verstärken, der Hebel der Kreativität. Jedes System hat die Möglichkeit zur Stabilität und zur Weiterentwicklung in sich. „Diese Offenheit ist die zentrale Voraussetzung für die mögliche Stabilität und Flexibilität einer Systemstruktur,“ wie Toifl es ausdrückt. (Toifl, S. 80)
Durch eine entscheidende Änderung in den Rahmenbedingungen kann sich der Zustand eines Systems aber auch auf einen Bifurkationspunkt hinbewegen, so daß es zu massiven Zustandsveränderungen in einem bis dahin stabilen System kommen kann.
In den psychischen Systemen des Menschen kann man ebenfalls Bifurkationspunkte finden. Diese führen zu einer Änderung oder Verstärkung des Verhaltens. „Wann und ob solche Bifurkationen in dem einen psychischen System zu Gesundheit und in dem anderen System in Richtung Krankheit führen, kann nicht verallgemeinernd gesagt werden, da ein nichtlineares komplexes System, wie es die menschliche Psyche darstellt, nur individuell verstanden werden kann.“ (Toifl, S 82)
Ein System kann sowohl durch interne, als auch durch externe Wirkungen an einen kritischen Punkt gelangen. Jedes System versucht durch Fluktuation (Schwankungen) kleine Störungen in seine Struktur zu integrieren. Es kann jedoch eine winzige Kleinigkeit dazu führen, daß eine Integration nicht mehr möglich ist. Es kommt dann zu einem Symmetriebruch, wie Feuser (Feuser 1995, S. 109 f) schreibt. An diesem Punkt wird das System extrem chaotisch. Das Chaos kann hier als Versuch des Systems verstanden werden, verschiedene Ordnungsversuche zu unternehmen. Wobei verschiedene Zustände so schnell abwechseln können, daß wir darin keine sichtbare Ordnung erkennen. Jede Ordnung, die das System nach einem Symmetriebruch einnimmt, ist für das System gleich „normal“, weil es eben aus vielen Möglichkeiten ausgewählt hat.
Sobald ein System sich von seinem üblichen Zustand durch Störungen von seinem stabilen Zustand entfernt und in Folge auf einen neuen Zustand hin bewegt, muß es an einem bestimmten Punkt eine Auswahl treffen. Es muß darüber entscheiden, ob es z. B. eine katatone oder paranoide oder depressive Psychose, ein Koma oder ein apallisches Syndrom oder eine geistige Behinderung oder eine Epilepsie, einen Autismus oder anderes ausbildet. Eine Vorhersage ist dabei unmöglich! „Nach einigen Versuchen, von denen manche erfolglos sind, und die wir meist im Vorfeld einer späteren auffälligen Symptomatik nicht bemerken, werden bestimmte Fluktuationen die Oberhand gewinnen und das System wird diese stabilisieren. Das kennzeichnet das Phänomen der ‚Bifurkation‘.“ (Feuser 1995, S. 114)
Jeder Weg der eingeschlagen wird, ist eine Möglichkeit des Systems sich zu stabilisieren. Dabei hat es eine Wahl getroffen, die so normal ist, wie jede andere, die es hätte treffen können.
Um auf die Defination von Krankheit zurückzukommen bedeutet dies: „Jede ‚Pathologie‘ ist so normal wie das was wir als nicht pathologisch beschreiben!“ (Feuser 1995, S.110)
Diese Vorgehensweise an Bifurkationspunkten verweist auf die autopoietische Struktur lebender Systeme, dessen Funktion es ist, sich ständig selber zu erneuern.

Abb. 12: Das Modell der „Bifurkation“ und „Hysterese“ (Feuser 1995, S. 113)
Inhaltsverzeichnis

Abb. 10: Die Entstehung einer Flutwelle (Briggs/Peat, S. 179)
Der schottische Ingenieur John Scott Russell fand 1934 folgendes heraus: Er beobachtete bei einem Ausritt mit seinem Pferd in der Nähe von Edinburgh Wellen in einem Fluß. Die Wellen rollten mit hoher Geschwindigkeit vorwärts, nahmen dabei die Form einer großen einzelnen Erhöhung an, und überschlugen sich schäumend. Nur eine Welle tat dies nicht. Sie begleitete ein Schiff in gleicher Form und Geschwindigkeit, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Er konnte sich diese Wellenform damals nicht erklären. Diese unnatürlichen Wellen sind heute als „Solitonen“ bekannt.
Die Wissenschaftler wissen heute, daß diese Wellen ihre Stabilität „nichtlinearen Wechselwirkungen verdankt, die individuelle Sinuswellen aneinanderkoppeln. Solitonen werden in Grenzbereichen geboren. Ist an der anfänglichen Wechsel-wirkung zuviel Energie beteiligt, so bricht die Welle in Turbulenz. Ist zuwenig Energie vorhanden, so löst sich die Welle in nichts auf. Hier erzeugen nichtlineare Wechselwirkungen bei kritischen Werten nicht Chaos, sonder sie führen zur spontanen Selbstorganisation von Gestalt. “ (Briggs & Peat, S. 174)
Solitonen sind auch in biologischen Systemen wichtig. Alan Hodgkin arbeitet seit 1945 im Laboratorium in Cambridge. Er machte Forschungen mit Nervenfasern von Tintenfischen. Dabei stellte er fest, daß die Nerventransmission keineswegs dem Transport von Nachrichten in einer Telefonleitung gleicht; vielmehr handelt es sich hier um einen eng begrenzten Puls, der die Nervenfasern mit konstanter Geschwindigkeit und ohne Formänderung entlang läuft. Es kommt hinzu, daß der Puls nur entstehen kann, wenn eine gewisse kritische Energieschwelle erreicht. Für diese Forschungen erhielten Hodgkin, Huxley und Eccles den Nobelpreis. Sie zeigte, daß Nervenimpulse in einer Form transportiert werden, die wir heute als Solitonen bezeichnen – mit konstanter Geschwindigkeit und ohne Dissipation. Zur Fortpflanzung und Wechselwirkung neutraler Solitonen gehört auch ein ‚Gedächtnis‘. Das Neuron behält eine Empfindlichkeit für Nachrichten, die es früher weitergegeben hat. Dadurch hat ein Netzwerk von Nerven ein ganzheitliches Gedächtnis für Nachrichtenmuster. (Briggs & Peat, S. 190) Dies spielt eine große Rolle auch bei unserem Schmerzempfinden. Wenn wir uns, angenommen unseren Fuß verbrennen, so muß der Schmerz einen fast zwei Meter langen Nervenweg bis zum Gehirn zurücklegen, dabei muß er auch noch ungefiltert ankommen, denn sonst können wir nicht richtig reagieren.
Wo immer dynamische Stabilität dauerhaft überlebt, da sollte man nach Solitonen Ausschau halten.
Zeit ist uns in unserem Alltag bekannt als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wobei die Gegenwart meistens die dominanteste Rolle einnimmt. Von ihr aus beurteilen wir die Vergangenheit. Manchmal wünschen wir zu sehen was die Zukunft uns bringen wird und lesen zu diesem Zweck Horoskope oder suchen sogenannte Wahrsager auf.
Cramer schreibt, daß bereits mit dem Beginn der abendländischen Philosophie im alten Griechenland das Nachdenken über die Zeit angefangen hat. Philosophieren war von Anfang an philosophieren über die Zeit. Bereits zu Anbeginn gab es einen uneinheitlichen Zeitbegriff.
Über einige unterschiedliche „Zeitansichten“ der alten Griechen berichtet Cramer:
Heraklit aus Ephesus (ca. 500 v. Chr.) sagt: „Es ist unmöglich zweimal in denselben Fluß zu hineinzusteigen.“ (Cramer, S. 16) Er meint damit wohl, daß kein Ereignis je wiederholt werden kann. Identische Wiederholungen gibt es nicht. Heraklit spricht hier gleichnishaft den irreversiblen Charakter der Zeit an, den Zeitpfeil.
Anaximander aus Milet (geb. 610 v. Chr.) hat eine andere Auffassung von Zeit. „Aus welchen (seienden Dingen) die seienden Dinge ihr Entstehen haben, dorthin findet auch ihr Vergehen statt, wie es in Ordnung ist, denn sie leisten einander Recht und Strafe für das Unrecht, gemäß der zeitlichen Ordnung.“ (Cramer, S. 17) Er sagt damit, daß alles dorthin zurückkehrt woher es gekommen ist. Also, daß die Zeit an und für sich reversibel ist. Sein Denken bildet einen Zeitkreis.
„Platon schon unterscheidet eine Welt der Zeitlosigkeit und der Zeit. Heute wird dies als reversible und irreversilbe Zeit bezeichnet tr – ti). Die Zeitlosigkeit (tr) gewissermaßen ein unerreichbares Ideal, und die Zeit, in der sich etwas ereignet (ti), unerklärbar unbeschreibbar. Beide hängen in einer Art Getriebe zusammen, in welchem das Weltgeschehen aufgehängt ist.“ (Cramer, S. 23)
In seinem Gedicht Metamorphosen beschreibt Aristoteles Veränderungen. Veränderungen aber bedeuten Werden. Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) Für Aristoteles steht nicht das Sein, sondern das Werden im Mittelpunkt der Betrachtungen, die Veränderungen. In der Metamorphose gibt es also ein früher oder später, weil sein Prozeß richtungsgebunden ist. Jeder Prozeß ist damit gerichtet, irreversibel. Demzufolge hat jeder Naturprozeß seine eigene Zeit, sein Eigenzeit. Damit gibt es keine Einheit der Natur mehr. (vgl. Cramer, S. 27)
Das abendländische Denken ist und bleibt durch die beiden Denkweisen geprägt: Die absolute Zeit, eingebettet in das absolute Sein in der Ideenwelt des Platon – und die Zeit des Werdens, die irreversible Zeit des Aristoteles.
Im Weltbild von Newton gab es den dreidimensionalen Raum der Euklidischen Geometrie. In ihm spielten sich alle physikalischen Vorgänge ab. Capra schreibt: „Es war ein absoluter Raum, ein leerer Behälter, unabhängig von den physikalischen Phänomenen, die sich in seinem Inneren ereigneten. ‚Der absolute Raum ist seinem Wesen nach so beschaffen, daß er ohne Rücksicht auf etwas außerhalb liegendes immer gleich und unbeweglich bleibt‘, wie Newton selber sagt. Die Zeit floß dabei gleichförmig von der Vergangenheit in die Gegenwart und die Zukunft. Sie hatte keine Verbindung mit der Welt der Materie. Capra zitiert Newton: ‚Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließt von sich aus gemäß ihrem Wesen gleichförmig und ohne Rücksicht auf äußere Dinge.“ (Capra/Steindl-Rast, S. 64 – 65)
Reversible Zeit:
Der reversible Zeitbegriff ist jener der klassischen Physik. Dieser entspricht einer linearen Denkweise. Durch klare mathematische Formeln kann man den exakten Zustand in der Vergangenheit bestimmen oder auf die Zukunft schließen. Das ganze System ist reversibel. Kennen wir nur Teile genau genug, so können wir sowohl ihre Vergangenheit als auch ihre Zukunft bestimmen. Dieser Zeitbegriff entspricht somit auch jenem Anaximander aus Milet. (s.o.) Alles ist einem wiederkehrenden Kreislauf unterworfen. (vgl. Burtscher, S. 17)
Irreversible Zeit:
Cramer beschreibt diesen Zeitbegriff folgendermaßen:
„Komplexe Systeme – sowohl chaotische als auch geordnete – sind letzten Endes nicht analysierbar, nicht auf Teile reduzierbar, weil die Teile durch Iteration und Rückkoppelung ständig aufeinander zurückwirken.“ Durch die Wechselwirkung der einzelnen Teile kann man nie ein einzelnes herausnehmen und behaupten, Zeit spiele keine Rolle. Den das System als Ganzes ist einer ständigen Veränderung, Bifurkation und Iteration unterworfen. Jedes System, jeder Mensch hat somit seine ganz eigene Zeitrichtung.
„So wird die Zeit zum Ausdruck der ganzheitlichen Wechselwirkung des Systems, und diese Wechselwirkung reicht auch nach draußen. Jedes komplexe System ist ein sich wandelnder Teil eines noch größeren Ganzen, die schließlich auf das allerkomplexeste aller dynamischen Systeme hinführen, das System, das schließlich alles umfaßt, was wir unter Ordnung und Chaos verstehen – das Universum selbst. In ideal isolierten Systemen könnte die Zeit umkehrbar sein, aber in jedem wirklichen System ist die Symmetrie der Zeit gebrochen.
Zeit ist der große Pfeil, der alle Systeme aneinanderkoppelt, aber auch die Menge von Pfeilen, die alle die Bifurkation und Veränderungen individueller Systeme ausmachen. Jeder von uns hat seinen eigenen autonomen, unumkehrbaren Pfeil, aber dieser ist eng verknüpft mit dem unumkehrbaren Pfeil des Universums.“ (Cramer, S 222)
In seinem Modell der Entwicklungslogik baut Feuser auf diesem Zeitbegriff auf. Er sieht jedes Individuum als ein offenes und sich in Bewegung befindliches System, das seine spezifische Eigenzeit hat. Erst durch die Zeit wird Strukturbildung und somit Entwicklung möglich. Feuser spricht in seinem Modell von einer „intrinsischen, extrinsischen und von einer Verhältnis-Zeit“.
Jeder Mensch hat seine persönliche Eigenzeit, seine System-Eigen-Zeit, die „intrinsische Zeit“. Jeder hat jedoch außerdem die Möglichkeit die Zeit des anderen Menschen wahrzunehmen, nach Feuser wäre das die „extrinsische Zeit“, außerdem können sich jedoch zwei Menschen ihre Zeit durch Austausch, d.h. Dialog. synchronisieren, sich auf eine „Verhältniszeit“, einigen und ihre Systeme in einem gemeinsamen Phasenraum integrieren. (vgl. Feuser, 1995, S. 94ff)
„Im Sinne der Relativitätstheorie ist der Raum nicht dreidimensional, und die Zeit ist keine selbständige Einheit. Beide hängen eng zusammen und bilden ein vierdimensionales Kontinuum, die ‚Raum-Zeit‘.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 208) Seit Einstein können wir deshalb nie von einem Raum sprechen ohne die Zeit einzubeziehen. „Die vierte Dimension, Zeit, hat allerdings Eigenschaften, die sich von denen der drei Raumdimensionen subjektiv, das heißt in unserer Wahrnehmung unterscheiden. Da wir und alles, was ist, vom Fluß der Zeit getragen werden, sozusagen in ihm eingesponnen sind, fehlt uns der objektive Abstand, den wir den Raumebenen gegenüber haben.“ (Watzlawick, S. 221)
„Einstein entwickelte durch die Zeitdilatation (Zeitausdehnung) ein Drei-Zeiten-Modell, das in der Pädagogik durch Analogiebildung große Erklärungsmöglichkeiten bietet.“ (Burtscher, S. 19)
In oben angeführtem Sinn ist die Lebensgeschichte eines Menschen einem Zeitpfeil unterworfen. Leben ist somit ein lebensgeschichtlicher Prozeß. Zeit schlägt sich als individulle Biogaphie nieder, von der Konzeption des Menschen bis zu seinem Tod. Der Zeitbegriff als Prozeß verstanden, verweist immer auf etwas Werdendes und ist auf eine Zukunft ausgerichtet. Allerdings entspricht ein Lebensweg nicht einem linearen Prozeß. Leben gerät oft an entscheidende Einschnitte, in denen es sich radikal verändert. In der Chaostheorie nennt man diese Punkte Bifurkationspunkte. Dies bedeutet einen entscheidenden Einschnitt, der sich an einem Punkt ergibt, bei dem ein stabiler Zustand in einen kritischen Zustand übergeht. Welche Bedeutung dieses Ereignis letzten Endes hat, liegt an der individuellen Bewertung. An solchen kritischen Punkten kann sich die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit der Neuorientierung ergeben. Leben ist nicht nur von seiner Natur her, sondern auch biographisch betrachtet unumkehrbar.
„Systeme, die durch chemische Iteration hervorgebracht werden, lassen vom Gleichgewicht und Grenzzykelverhalten bis zu Periodenverdoppelung, Chaos, Intermittenz und Selbstorganisation all das wiederfinden, was wir früher beschrieben haben. Solche Systeme strukturieren den Raum, indem sie die reagierenden Moleküle in Muster bestimmter Form und Größe anordnen, und sie zeigen die Zeit an, indem sie sich ständig entwickeln und verändern, Selbst wenn dieselbe Grundorganisation beibehalten wird, bleiben sie sich doch nie genau gleich.“ (Cramer, S. 208)
Dieses Denken geht vor allem auf llya Prigogine, Nobelpreisträger für Chemie 1977 zurück. Er suchte nach dem Geheimnis, das Ordnung aus dem Chaos entspringen läßt. „Zusammen mit Poincar6 ist er vielleicht das Urbild eines Chaoskenners“, wie es Briggs und Peat ausdrücken (S. 199). Er untersuchte das Verhalten von Systemen, die sich fern vom Gleichgewicht befinden. Er entdeckte dabei, daß in weit vom Gleichgewicht entfernten Zuständen Systeme nicht nur untergehen, sondern auch neu geboren werden.
Im Mittelpunkt von Prigogines Denken steht die Vision der dissipaitiven Strukturen. Der Name „dissipative Struktur“ drückt ein Paradox aus. Dissipation läßt Chaos und Auseinanderfallen denken; Struktur ist das Gegenteil davon. Dissipative Strukturen sind Systeme, die ihre Identität nur dadurch behalten können, daß sie ständig für die Strömungen und Einflüsse ihrer Umgebung offen sind. (vgl. Briggs & Peat, S. 207)
„Heute ist es ein Gesetz, daß weit vom Gleichgewicht entfernte Zustände im nichtlinearen Bereich Strukturen hervorbringen, Ordnung im Chaos schaffen. Weit vom Gleichgewicht entfernt hat die Materie radikal neue Eigenschaften.“ (Briggs & Peat, S.208)
Dieser Zeitbegriff erinnert an das Bild eines Flusses in dem der Mensch als Teil schwimmt. In Fließgewässern spielen sich ständige Veränderungen in unterschiedlichen zeitlichen Mustern ab (saisonale Rhythmen der Biozönosen und der Wasserführung und -beschaffenheit, witterungsbedingte Schwankungen vieler Variablen bis hin zu größeren, erosiven Hochwässern mit nachfolgenden Sukzessionsprozessen), was bedeutet, daß die Charakterisierung des Ist-Zustandes nicht durch eine Momentaufnahme repräsentiert werden kann.“ (Vorstudie, S. 31) Das Leben des Menschen kann auch nicht als Momentaufnahme gesehen werden. Der Mensch ist ständig ein Werdender. Er ist vergleichbar mit dem Flußsystem, in dem der einzelne sich seinen Weg sucht. Schotter wird am Rande ablagern (Lebensereignisse), der vielleicht an verschiedenen Punkten zu Furkationen (Verzweigungen) oder Biegungen führt. An solchen Punkten wird sich mehr oder minder ausgeprägt entscheiden, welche Richtung der Fluß (Leben) weiter nimmt. Dadurch werden viele andere Möglichkeiten ausgeschlossen. Prinzipiell gilt jedoch: „Ökosysteme generell und somit auch Fließsysteme sind zur Selbstregulation befähigt, diese bewirkt, daß durch äußere Impakte (z.B. Erdrutsche) oder intere Impulse (z.B. Massenvermehrung bestimmter Arten) verursachte Veränderungen um einen mittleren Zustand herum pendeln, der von den längerfristigen Rahmenbedingungen (vor allem Klima und Umland) bestimmt wird, solange diese Impakte oder Impulse nicht ein bestimmtes Ausmaß überschreiten.“ (Vorstudie, S. 31) Das würde übertragen auf den Menschen bedeuten, daß er durchaus fähig ist, sich in diesem Lebensfluß selber zu entwickeln, solange sowohl seine internen Bedingungen (z. B. psychische Belastungen) oder externen Bedingungen (gewaltsames Einwirken durch äußere Umstände) ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Etwas ist gewiß: Der Fluß des Lebens geht in der Zeit weiter, bis er sich in der Unendlichkeit des Meeres (Tod) verliert.
Dieser Begriff wurde grundlegend von Maturana und Varela geprägt. Ursprünglich kommt er aus dem Griechischen und bedeutet Selbsterneuerung oder Selbsterschaffung. (griechisch: autos = selbst; poiein = machen). Die Biologen verwenden diesen Begriff für Lebewesen als Einheiten, die sich letzten Endes immer wieder selber erzeugen.
Ein typisches Beispiel hierfür ist die Zelle. Jede Zelle ist grundsätzlich begrenzt durch ihre Membran. Sie bildet die äußere Grenze des Systems. Dennoch hat sie die Aufgabe an verschiedenen chemischen Austauschprozessen mit anderen Zellen, als auch mit der eigenen Erneuerung nach innen, teilzunehmen. Jede Zelle erneuert sich selbst und ist gleichzeitig offen für ihre Umweltsituation.
„Jedes lebende System und damit auch der Mensch ist ständig damit beschäftigt zu überleben. Leben in diesem Sinn bedeutet ständige Selbsterschaffung und damit ständige Entwicklung. Diese Entwicklung erfolgt durch Sturkturveränderung innerhalb des jeweiligen Systems. Nur das System selbst kann den Wandel der Strukturen durchführen. So gesehen bildet es eine abgeschlossene „operationale“ Einheit. Jedes lebende System ist autonom. […] Weil es sich durch seine autonome Struktur bestimmt, ist es – anders ausgedrückt – strukturdeterminiert. Die Veränderung der Struktur geschieht ständig, und solange die Organisation aufrecht erhalten bleibt, lebt das System als solches.“ (Burtscher, S. 20) Die Geschichte eines Systems ist somit die Geschichte des strukturellen Wandels einer Einheit ohne Verlust ihrer Organisation. Der strukturelle Wandel findet laufend statt. Er wird entweder ausgelöst durch die innere Dynamik des Systems oder durch aus dem umgebenden Milieu stammende Interaktionen. Das System ordnet die Interaktionen mit dem Umfeld immer im Sinne der eigenen Struktur, welche ja wiederum auch ständig im Wandel begriffen ist. Dieser ständige Wandel findet solange statt solange ein System lebt. (vgl. Maturana/Varela, S. 84)
Die autopoietische Struktur eines Systems, dessen Funktion es ist, sich ständig selbst zu erneuern, hat Feuser mit folgenden Eigenschaften zusammengefaßt:
- sie sind dissipativ, d.h. offen und referentiell zu ihrer Umwelt und dies
- in altruistischer Weise. d.h. keine Evolution ohne Koevolution! Sie sind
- ’selhstrefertiell‘ in bezug auf die eigene Evolution und insofern organisiert, als die intern ablaufenden Prozesse miteinander verknüpft sind und insofern strukturiert, als die Gesamtcharakteristik aller ablaufenden Prozesse ein ‚funktionelles System‘ bilden, d.h. sie besitzen
- Individualität im Sinne ihrer Autonomie gegenüber der Umwelt, und sie sind
- distinkte Entität im Sinne ihrer jeweils individuellen raum-zeit-strukturellen Verfaßtheit. Dies wesentlich durch ihre Fähigkeit zur Erinnerung an ihren Anfang, wie wir noch sehen werden. Darin begründet sich
- ein ganzheitliches Systemgedächtnis,
- Information ‚als jede nichtzufällige räumliche oder zeitliche Struktur oder Beziehung von Größen‘ und
- Wissen im Sinne der aus der Interaktion zwischen den Systemen und/oder ihrer Umwelt resultierenden Erfahrung, das sich darin ausdrückt, ‚daß das System selbst zur Stabilität gegenüber Fluktuationen gefunden hat, und dieses Wissen stellt nichts anderes dar, als die in ein bestimmtes Beziehungssystem gebrachte Erfahrung der Wechselwirkung zwischen System und Umwelt‘. Darin liegt
- die Wurzel des ‚Bewußtseins‘, im Sinne der Autonomie, die das System in seinerdynamischen Beziehung zur Umwelt selbst erhält.“ (Feuser 1996, S. 17)
Auopoiese zeigt die Grundbedingungen für die dynamische Existenz von Ungleichgewichtsstrukturen auf. Diese Bedingungen, – teilweise Offenheit gegenüber der Umwelt, ein makroskopischer Systemzustand fern vom Gleichgewicht und autokatalytische Eigenverstärkung bestimmter Prozeßstufen, – kehren bei selbstorganisierenden Systemen immer wieder. Gleichgewicht bedeutet in diesem Fall Stillstand und Tod.
Inhaltsverzeichnis
- 6.1 RHYTHMUS – GESCHICHTLICHE ÜBERLEGUNGEN
- 6.2 RHYTHMIK – EIN DIALOGISCHES PRINZIP
- 6.3 RHYTHMUS – LERNEN DURCH BEWEGUNG
- 6.4 RHYTHMUS – BEWEGUNG ZWISCHEN INNEN UND AUSSEN
- 6.5 RHYTHMUS – ZEITRÄUME
- 6.6 RHYTHMUS – DER INBEGRIFF ALLEN LEBENS
- 6.7 RHYTHMUS – EIN KÜNSTLICHES KONSTRUKT
- 6.8 RHYTHMUS – BEDEUTUNG FÜR DIE FLIESSGEWÄSSER
,Gesunde“ und widerstandsfähige Ökosysteme befinden sich meist fern vom Gleichgewichtszustand, der durch einen Punkt innerhalb des „Attraktorenbereiches“ dargestellt werden kann. Sie sind im Phasenraum ständig in Bewegung und halten sich bevorzugt nahe den Grenzen des Attraktorenbereichs auf. Diese ständige Instabilität führt dazu, daß das System als gesamtes stabil bleibt und sich dennoch weiterentwickeln kann. (vgl. Jantsch, S. 107)
Rhythmus ist ein Attraktor, der sowohl die Richtung als auch die Geschwindigkeit bestimmt, die ein dynamisches System nimmt. Rhythmus verleiht einem System eine gewisse Festigkeit, obwohl es ständig in Bewegung ist. Im Folgenden beschreibe ich einige Zusammenhänge von Rhythmus und Entwicklung.
Die Rhythmusbewegung in Deutschland zeigt, daß es von Anfang an im Wesentlichen zwei Hauptrichtungen gab.
1.) Die eine Richtung geht auf den Genfer Musikprofessor Emile Jaques-Dalcroze zurück. Dalcroze ging zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts davon aus, daß die musikalischen Rhythmen lebendiger erlebt und nachvollzogen werden können, wenn ihre Strukturen körperlich sichtbar werden. Die Wechselbeziehung zwischen musikalischem und körperlichem Rhythmus erweckt ein rhythmisches Bewußtsein. Dieses Bewußtsein führt zu einem tieferen Verständnis für die Musik und ebenso zu einem Ausgleich in psychischen und physischen Körpervorgängen. Seiner Meinung nach war rhythmisches Empfinden eine Frage der Koordination von Bewegung in bezug auf (Muskel-) Kraft, Raum und Zeit. Er entwickelte für das rhythmische Empfinden eine Körper- und Bewegungsschulung. Diese Methode fand als „rhythmische Gymnastik“ ihren Einzug in die Musikerziehung. Seine Schülerin Elfriede Feudel sah die „Musik als ein Mittel zum Zweck, um zeitliche, räumliche, kräftemäßige und formgebende Verhältnisse zu rhythmisieren.“ (Frohne, S. 13) Diese Verhältnisse konnten sich auf Bereiche wie Bildende Kunst, Dichtung und alle Lebensvorgänge in der Natur beziehen. Mimi Scheiblauer, eine der Schülerinnen von Dalcroze arbeitete seine Ideen zu einer heilpädagogischen Arbeitsweise aus. Sie ging von der Bewegung aus und ihre Therapie kann als Bewegungstherapie bezeichnet werden. Hingegen kann die Dalcroze-Richtung von ihrem Ursprung als Musiktherapie bezeichnet werden.
2.) Die andere Richtung ging von Anfang an vom körperimmanenten Rhythmus aus, der auch ohne Musik vorhanden ist. Namen wie Luwig Klages, Rudolf Bode, Rudolf von Laban, Mary Wigman und Hans Brandenburg gingen bereits 1913 als „Münchner Rhythmusrebellen“ in die Geschichte ein. Rhythmus wurde als Phänomen gesehen, das sowohl der körperlichen Bewegung als auch der Musik übergeordnet ist. Rhythmus war Mittel zur „aktiv-revolutionären“ Veränderung der bürgerlichen Gesellschaft, aber auch ein „erlösendes kosmisches Phänomen“. Der Mensch sollte für den Rhythmus offen werden. Es gab einen körperimmanenten Rhythmus, der als Entsprechung des naturhaften oder kosmischen Rhythmus geweckt werden kann. Rhythmus war kein „geistig und willensmäßiges, sondern ein rationales, körperhaftes Phänomen.“ (Frohne, S. 14) Rhythmus als Ausdruck des Lebendigen war nicht mehr von der Musik abhängig. Es wurde sehr großen Wert auf die Schulung der Sinne bzw. der Wahrnehmung gelegt. Daraus haben sich in der Folge verschiedene körperbezogene Verfahren entwickelt, die zum Teil ganz ohne Musik arbeiten.
„Rhythmik ist gar vielerlei“, wie Mimi Scheiblauer sagt. Sie spricht dabei von einem dreifachen Prozeß: Erleben – Erkennen – Benennen und geht davon aus, daß der Mensch durch seine Sinneserfahrungen die Welt erobert. Es gilt deshalb seine Neugier zu wecken, in dem man ihm Möglichkeiten anbietet durch die er die Welt erleben, erkennen und letzten Endes benennen lernen kann.
Es geht immer um das praktische sich Einlassen, um das tätige Erkennen und das wirklichkeitsformende Benennen. Bei verschiedenen Übungen können Erfahrungen gemacht und dabei die eigenen Fähigkeiten kennengelernt werden. Es geht dabei nicht so sehr um „das Sehen sondern um das Schauen, nicht um das Hören sondern um das Horchen.“ (Burtscher, S. 56) Es geht immer um die Beziehung zu etwas oder zu jemandem. Für die Rhythmik ist der Mittelpunkt das „In-Beziehung-stehen“. Es geht um die Beziehung zu Dingen (Arbeitsmaterialien wie Tücher, Steine usw.) aber ebenso um die Beziehung zum Nächsten (Wie gestalte ich Nähe und Distanz zu den anderen Menschen.) Erziehung ist immer wechselseitiges Geschehen. Übungen, bei denen es um das Führen und Folgen, oder Durchsetzen und Nachgeben geht, können ausprobiert werden, aber es geht auch darum, wo kann ich Verantwortung übernehmen bzw. wo kann oder will ich sie abgeben. Es geht um das praktische Erproben ebenso wie um die theoretische Reflexion.
Entwicklung ist „Ent-wicklung“ ein Leben lang. Wir befinden uns in einem ständigen Wandel und sind ausgerichtet auf ein ständiges Werden, das heißt wir befinden uns ständig in Bewegung. Bewegung aber dauert nicht nur bis zur Pubertät sondern erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne. Hans von Lüpke bezeichnet „Das Spiel mit der Identität als lebenslangen Entwicklungsprozess“. (von Lüpke. S. 82) Wobei das Entdecken von etwas Neuem der Anfang eines neuen Lernprozesses ist. „Wir haben festgestellt, daß das Erscheinen einer neuen Bewegung oder Position zugleich auch der Anfang eines neuen Lernprozesses ist. Dieser Lernprozeß dauert oft noch Monate. Der Säugling sucht die neu entdeckte Position mit der Zeit immer häufiger auf.“. (von Lüpke, S. 85) Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die, nicht die Frage „ob“ etwas schon geleistet werden kann, sondern „wie“. Dabei ist das „Ausprobieren dürfen“ im Vordergrund. „Das Spiel mit den unterschiedlichen Möglichkeiten von Bewegung etwa läßt die Varianten herausfinden, die als spezifisch eigene empfunden werden und damit Identität wahrnehmbar machen. (von Lüpke, S. 85)
„Entwicklung über die Lebensspanne geschieht in Auseinandersetzung zwischen der Person und ihrer Umwelt, wobei sich Veränderungen auf beiden Seiten wechselseitig bedingen können“, schreibt Silbereisen in „Entwicklung im Netzwerk“.(von Lüpke, S. 12) Rhythmik, so wie ich sie kennenlernen durfte, entspricht diesem Konzept. Durch die verschiedenen Übungen können praktische Erfahrungen gemacht werden und durch die theoretische Reflexion darüber kann das, was das typisch Persönliche ist, benannt werden. Die aus diesen Übungen gewonnen Erkenntnisse können wesentlich dazu beitragen, daß wir dialogfähiger werden. Die wesentliche Rolle des Dialogs für menschliche Entwicklung wurde im Kapitel „Dialog“ behandelt. Um dieses dialogische Prinzip der Rhythmik geht es auch Isabelle Frohen, wenn sie folgende Worte von Pearls (Gestalttherapie) erwähnt: „In Wirklichkeit gibt es niemals so etwas wie ein Individuum oder eine Umwelt. Sie bilden zusammen eine untrennbare Einheit, wobei z. B. ein Reiz und die Bereitschaft oder die Fähigkeit, sich stimulieren zu lassen, nicht zu trennen sind“. (Frohne, S. 33)
Der Körper ist jener Ort in dem wir mit unserer Psyche unserem Geist wohnen. „Der Leib ist der Ort unseres Eingelassenseins in der Welt, der Ort wo Raum und Sein identisch sind. Die Welt wird damit zugleich zum Horizont des Leibes. Seine Wirklichkeit endet nicht an den gestalthaften Grenzen des Körpers, sondern er ist durch Hören, Sehen, Riechen und Fühlen, durch Bewegung, Ernährung, Vermehrung und Denken in diese Welt hineinverwoben. Der Leib als Ausdruck des ganzen Menschen ist unser Mittel überhaupt, diese Welt zu erleben. Nur das sich bewegende ‚Leib-Subjekt‘ kann diese Welt als Wirklichkeit erfahren. (vgl. Frohne, S. 65) Das kleine Kind lernt die Welt mit all seinen Sinnen kennen. Es schaut, krabbelt, klettert und steckt alles in den Mund. Es bewegt seinen Körper in die Welt hinein und macht sie so zu seiner eigenen. Jeder tut dies so lange er lebt, auf die ihm mögliche und ihm eigene Art und Weise. Dadurch schafft jeder seine Identität in Auseinandersetzung, in einem ständigen Dialog mit seiner Umgebung. Oder wie Feldenkrais sagt: „Ein jeder bewegt sich, empfindet, denkt, spricht auf die ganz ihm eigentümliche Weise, dem Bild entsprechend, das er sich im Laufe seines Lebens von sich gebildet hat.“ (Feldenkrais 1968, S. 31)
„Bewegung ist – daran besteht kein Zweifel mehr – die Basis zum Aufbau eines normalen Weltbildes und von außerordentlicher Wichtigkeit für das Erfassen und das Zur-Verfügung-Haben der Welt.“ (Frohne, S. 67) Beeinträchtigte Motorik rührt einerseits zu einer unvollkommenen Selbsterfahrung, andererseits zu einer unvollkommenen Fremderfahrung. „Es stellen sich Mängel im kommunikativen und sozialen Bezug ein, weil keine Verbindungen zu Menschen und Dingen hergestellt werden und die zur Welterschließung und Welterfahrung notwendige intentionale Beziehung und Kontaktaufnahme fehlt. Es fehlt auch die Differenzierung des eigenen Körpergefühls, der eigenen Bewegungs-möglichkeiten und des -ausdrucks. Diese Differenzierung ermöglicht aber erst die Erfahrung der Ich-Identität.“ (Frohne, S. 67) Eine Folge des Mangels kann sein, daß sich der Mensch in seiner Umwelt fremd fühlt, ihr gegenübertritt anstelle in ihr zu wohnen. Bewegung ist sowohl „Eindruck“ als auch „Ausdruck“. Unsere Gemütsbewegungen finden ihren Ausdruck in unseren Körperbewegungen, sie können nicht gelehrt werden, sie sind einfach spontan da, Ausdruck unserer Identität. (Frohne, S. 69)
Umwelt und Erfahrung spielen bei der Entwicklung des Menschen eine bedeutende Rolle. Jeder Mensch wird sich im Wesentlichen so entwickeln, wie es ihm seine Umwelt vorgibt und ermöglicht. Seine Sprache wird die seiner Eltern sein, ebenso oft die Art des Ganges, seine Mimik und Gestik. Der Mensch lernt aus Nachahmung. Individuelle Erfahrungen spielen deshalb beim Menschen eine sehr große Rolle.
Die Entwicklung der willkürlichen Bewegungen tritt erst im Laufe der Bildung der Pyramidenbahn auf Die Pyramidenbahn dient der Reizleitung vom Cortex zur Skelettmuskulatur und ist für alle willkürlichen Bewegungen von entscheidender Bedeutung. Die individuellen Erfahrungen, die ein Mensch aufgrund seiner Bewegungen macht, haben deshalb eine unmittelbare Bedeutung für seine Entwicklung. Lernen stellt deshalb für den Menschen eine normale Aktivität dar. „Es könnte offenbar so lange mit allen nur möglichen Kombinationen von Nervenverbindungen fortgesetzt werden, bis die individuelle Erfahrung zur Ausbildung der Verbindungen führt, die dann bevorzugt und aktiviert wird. Das Verhaltensmuster einer Tätigkeit ist daher im wesentlichen persönlich und zufallsbestimmt […] Die enormen Fähigkeiten, individuelle Nervenbahnen und muskuläre Bewegungsmuster zu bilden, lassen jedoch auch das Erlernen fehlerhafter Funktionen zu. Je früher ein solcher Fehler auftritt, umso stärker prägt er sich ein. Fehlerhaftes Verhalten zeigt sich in den ausführenden motorischen Mechanismen. Später, wenn sich das Nervensystem in seiner Entwicklung an diese unerwünschte Motilität angepaßt hat, hat es den Anschein, als sei es ein inhärentes und unveränderliches Merkmal der betroffenen Person. Das wird im großen und ganzen auch so bleiben, es sei denn, die Nervenbahnen, die für diesen unerwünschten Bewegungsablauf verantwortlich sind, werden aufgelöst und in einer besseren Konfiguration neu geordnet. Wir können jetzt verstehen, warum ‚die Lebensgeschichte des Individuums in seinen Cortex, ja sogar in den erregbaren Teil des Cortex geschrieben ist, in dem die Funktionsmuster relativ stabil sind‘. Die Muster des Motor-Cortex entwickeln sich beim Menschen während des Wachstums der Nervenbahnen und der Fortsätze der Nervenzellen und hängen in einem Maße von Umwelteinflüssen ab, wie man es in der gesamten Tierwelt nicht kennt.“ (Feldenkrais 1994, S. 75f) Die meisten willkürlichen Bewegungen sind von Nervenverbindungen abhängig, die in einem höheren Maß vorübergehender Natur sind als angeborenes Instinktverhalten. Aufgrund dieser Voraussetzungen kann der Mensch ständig lernen. Lernen ist eine spezifisch menschliche Eigenschaft. „Die Bildung neuer Konfigurationen aus den Elementen der Gesamtsituation früherer persönlicher Erfahrungen, kurz das Lernen. ist die Eigenschaft des Menschen, die ihn auszeichnet.“ (Feldenkrais 1994, S. 232) Lernen ist also chaostheoretisch gesehen ein ständiger Rückkoppelungs- und Iterationsprozeß.
Menschliches Lernen ist eng mit der Phantasie verbunden. Phantasie braucht einen Raum, in dem sie gelebt werden kann. Rhythmische Übungen sind der ideale Ort, Phantasien kreativ ausprobieren zu können. Durch das Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten ergeben sich mehr Wahlmöglichkeiten und es kann diejenige ausgewählt werden, die einem in einer bestimmten Situation am meisten Sinn macht. Nachdem menschliches Lernen ein Leben lang funktioniert, kann man immer nach anderen, besseren Möglichkeiten suchen. Dies ist dem Menschen aufgrund der Fähigkeit seiner Nervenbahnen zu immer neuen Vernetzungen möglich. „Die außergewöhnliche Eigenschaft der bewußten Innervationen (Leitung der Reize durch die Nerven zu den Organen) des Menschen beruht offenbar auf der einzigartigen Fähigkeit, neue Nervenbahnen, Assoziationen und Neugruppierungen der Zwischenverbindungen zu bilden. Diejenigen, die in der Phase entstehen, in der sich die Pyramidenbahn entwickelt, sind die stabilsten, obwohl auch sie weniger stabil sind als die der anderen Säugetiere.“ (Feldenkrais, 1994, S. 233)
Eine Änderung können wir dann erreichen, wenn wir die Dynamik unserer Reaktionen andern. „Eine solche Änderung in der Dynamik unseres Tuns ist gleichbedeutend mit einer Änderung in unserem Ich-Bild, einer Änderung in der Art unserer Beweggründe und mit der Mobilisierung aller betroffenen Teile unseres Körpers.“ (Feldenkrais 1968, S.31)
Aus ganzheitlicher Sicht lebt der Mensch in einem Beziehungsgefüge von Innen und Außen, welches er als ein vielschichtiges Ganzes begreift. Erleben und Verhalten als Ausdrucksformen von Innen und Außen sind als „Verschränkungen von Innen und Außen“ zu begreifen. Es geht um eine Einigung zwischen „Verinnerlichung von Äußerem und Entäußerung von Innerem“. (Frohne, S. 33)
Die Wahrnehmung von Innen und Außen ist eng mit Bewegung verbunden.
„Die Wahrnehmungsvorgänge vermitteln zwischen Innen und Außen, indem sie die Botschaften der sichtbaren Welt vom Bild, das der Gesichtssinn aufnimmt bis zu der Wahrnehmung der Bodenbeschaffenheit eines ansteigenden Weges durch den Muskel- und Lagesinn dem Subjekt unter Benutzung der entsprechenden Nervenbahnen zukommen lassen, wobei Vermittlung auch Veränderung des Wahrgenommenen einbezieht. Ebenso vermitteln sie das Innen an die Außenwelt. Über die auf Wahrnehmen erfolgenden Bewegungsantworten des Subjekts auf die Einwirkungen der sichtbaren Welt.“ (Frohne, S 34)
Ständig sich ändernde Rhythmen bestimmen unserem Leben. Denken wir nur, wir würden immer soviel Schlaf benötigen wie als Säugling. Das würde unsere Möglichkeiten drastisch einschränken. Hier müssen wir unseren Schlaf-Wachrhythmus beim Heranwachsen ständig ändern. Das ist notwendig, um uns weiterentwickeln zu können. Die Möglichkeit zur Veränderung bedingt letzten Endes Veränderung nicht nur im einzelnen Menschen, sondern in der gesamten Evolution. Da es in der Natur keine exakt sich gleich wiederholenden Rhythmen gibt, ist Veränderung durch Iteration jederzeit möglich. Bei einer Iteration wird alles schon Dagewesene bei jedem neuen Rechnungsschritt mit einberechnet. Somit können kleine Abweichungen und Änderungen im Rhythmus letzten Endes sich so aufsummieren, daß etwas völlig Neues entstehen kann.
Wir entwickeln uns in einem rhythmischen Austausch mit unserer Umwelt, dies unterstreicht bereits Goethe mit folgendem Gedicht:
Selige Sehnsucht
Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet, Das Lebendige will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.
In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest, Überfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsternis Beschattung,
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.
Keine Ferne macht dich schwierig,
Kommst geflogen und gebannt,
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Bist du Schmetterling, verbrannt.
Und solange du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
– bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.
(J. W. v. Goethe)
Goethe sagt mit diesem Gedicht ganz deutlich: Sterben und Werden gehören zusammen, sie sind ein grundsätzliches Prinzip, genauso wie Chaos und Ordnung, genauso wie reversible Zeit tr und irreversible Zeit ti. Die Liebe und das Vergehen der Liebe sind wesentlich innerhalb der Lebenspanne. Sie ist einem irreversiblen Prozeß unterworfen und doch immer wieder anders und dadurch einmalig. Sie ist geradezu die Antithese des Statischen. Liebe evoliviert sich über irreversible Zeitschritte, sie hat keine Uhren. Den Liebenden schlägt keine Stunde. Liebe ist nicht als Maschine denkbar, sie ist unberechenbar und einmalig. Liebe läßt sich nicht mit Liebe vergleichen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“(1. Kor, 13,13) Er unterstreicht damit die Bedeutung der Liebe für das Leben. Sie ist grundsätzlich, ohne Liebe gibt es kein Leben.
Aber dennoch gibt es nichts Vergänglicheres wie die Liebe. Viele Filme und Schlagertexte bezeugen dies. Da rückt die Liebe schnell in die Nähe des Todes. Liebe wird enttäuscht, erlischt und stirbt. Orgasmus heißt im Französischen: la petite mort (Der kleine Tod). Hinterher ist nichts mehr so wie früher, die Bifurkation hat in gewisser Weise die Vergangenheit nach dem chaotischen Durchgang ausgelöscht.
Liebe ist die treibende Kraft im Evolutionsprozeß, sie ist die stärkste Kraft im Reich des Lebendigen. Ausgehend von der Fortpflanzung der Bakterien, die keine sexuelle ist, war im Evolutionsprozeß die Entstehung der sexuellen Fortpflanzung jener Prozeß durch den ständig Neues und immer wieder Neues hervorgebracht wird. Das Entstehen von Neuen ist allerdings ohne das Sterben von Altem nicht denkbar. Alles Leben ist in einem grundlegenden Rhythmus zwischen Geburt und Tod eingebettet. Ein nicht aufzuhaltender Bewegungsablauf von der Zeugung bis zum Sterben und doch Festgehalten in der Einmaligkeit.
Jede Mutter weiß, wie wichtig eine koninuierliche feste Beziehung zu ihren heranwachsenden Kindern ist. Genauso wichtig ist jedoch auch eine Weiterentwicklung dieser Beziehung, damit die Kinder in ein selbständiges Leben finden können.
In diesem Prozeß wird das Bewegliche Moment der Liebe am Wichtigsten, denn dort wo Mutterliebe die Kinder binden will, wird sie schnell zu einer eingefrorenen Beziehung, die für das Heranwachsen der Kinder und ihre psychische Gesundheit gefährlich werden kann. Hingegen in einer Mutter-Kind-Beziehung in der ein ständiger Rhythmus von der Möglichkeit des Weggehens und Wiederzurückkehrens sich abwechseln kann, bedeutet eine Verläßlichkeit die für das ganze Leben ausschlaggebend sein kann, sowohl für die Kinder als auch für die Mutter.
Zeiträume werden uns vorgegeben, künstliche, gesellschaftlich bedingte Rhythmen bestimmen, daß wir in bestimmte Alterskreise eingeteilt werden. Kindheit, Pubertät, Arbeitsalter, Pensionsalter. Durch die Institutionalisierung der Zeitabschnitte die unser Leben maßgeblich mitbestimmen wird es für den einzelnen oft schwierig. Was ist, wenn ein sechsjähriges Kind noch nicht in die Schule paßt? Oder was ist, wenn sich einer ins Pensionsalter gekommen, noch nicht zur Ruhe setzen will?
Es stellt sich auch die Frage was mit Menschen geschieht, die sich diesem künstlich geschaffenen Rhythmus nicht anpassen können. Behinderte, kranke und alte Menschen werden in Institutionen untergebracht, damit sie den Arbeitsrhythmus der produktiven Bevölkerung nicht stören.
Rhythmus entsteht dann, wenn polare Wirkungskräfte eines Spannungsfeldes gestaltet werden. „Ein Rhythmus ist dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Polen des Spannungsfeldes eine ständige Bewegung, ein Hin und her, ein Auf und Ab, besteht, wobei die eine Bewegung immer schon die andere vorbereitet und der eine Pol immer das Gegenstück zum anderen ist. [..] Rhythmus ist eine dynamische Bewegung durch einen Nullpunkt, von welchem die Differenzierung ausgeht und in welchem sich die Gegensätze zugleich wieder verbinden. Der Nullpunkt ist ein dynamisch-flexibles organisimisches Gleichgewicht bzw. der rhythmische Ausgleich zwischen den polaren Kräften. Der Nullpunkt ist der scheinbar ruhende in sich aber ständig bewegte Moment, in welchem sich zwei gegenläufige Tendenzen treffen. […] Ein Rhythmus besteht in der Integration zweier gegenläufiger Tendenzen. Der erreichte Zustand ist jedoch schon wieder Pol eines neuen Spannungsfeldes. […] Der neue Zustand hat Ähnlichkeit mit dem vorigen, weil er alles beinhaltet, was vorher war, aber auch noch etwas neues, eine Variation aufzeigt.“ (Frohne, S. 27 f.)
Rhythmus ist ein Attraktor, der sowohl die Richtung als auch die Geschwindigkeit bestimmt, die ein dynamisches System nimmt. Ein Grenzzykelattraktor bestimmt in einem Raubtier-Beute-System die Art und Weise wie ein System von einem Grenzpunkt zum anderen pendelt. Der Rhythmus ist es also, der einem System die Festigkeit verleiht obwohl es ständig in Bewegung ist. Bewegung ermöglicht es letzten Endes, daß Rhythmen sich verändern können und doch stabil bleiben. Jeder der auf einen Berg steigt, weiß diese Fähigkeit seines Herzschlages und seiner Atemfrequenz zu schätzen. Würden wir nicht die Möglichkeit in uns haben, unsere Atmung und unseren Herzschlag ständig anzupassen, würden wir nicht auf den Berg kommen. Außerdem muß nach erfolgter Anstrengung sich beides wieder beruhigen und in einem gewissen Ruhezustand einpendeln. Es ist jedoch nicht nur eine körperliche Anstrengung nötig, um diesen Effekt auszulösen. Ein Prüfungstermin oder ein Arztbesuch kann das selbe auslösen. Frohne bezeichnet diese Vorgänge als Rhythmen in belebter Natur.
Nach Frohne gibt es auch Rhythmen in der unbelebten Natur, wie den periodischen Wechsel von Tag und Nacht, die Mondphasen, von Strahlungen u.v.a.m. Manche dieser Vorgänge sind uns im Alltag erkennbar, andere können nur mit Instrumenten gemessen werden. (vgl. Frohne, S. 31)
Rhythmen im psychischen Bereich sind nicht so eindeutig erkennbar. Sie werden in hohem Maße von inneren und von äußeren Faktoren bestimmt. Periodisch-zyklische Phasen von Aktivität und Passivität, Lust und Unlust, Regression und Realitätszuwendung, Freude und Trauer etc. können daher in ihren verschiedenen Schattierungen und Nuancen unterschiedlich lang ausfallen. Dennoch können auch hier polare Rhythmen wahrgenommen werden, weil das Erleben des einen Poles schon immer ein Gegenstück in sich einschließt.
Im sozialen Bereich ortet Frohne ebenfalls rhythmische Vorgänge. Diese sind etwa Kontakt und Rückzug, Verschmelzung und Trennung, Aktion und Reaktion. Führen und Folgen, Arbeit und Freizeit, usw. Sie sind schwer zu erkennen, weil sie stark situationsabhängig sind. (Frohne, S. 31)
Das ist ein völlig anderes Verständnis als die Rhythmen der neuen Musikrichtungen. Hier erfolgt oft ein statischer, oft technisch hergestellter Rhythmus, der sich unaufhaltsam wiederholt. Es mag manchmal gut sein, sich einem solchen Rhythmus anzuvertrauen, jedoch würden wir wie Aufziehpuppen wirken, wenn wir diesen Klängen immer folgen würden.
Unser Tagesablauf wird meist nicht mehr bestimmt von Tag und Nacht, von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Meist ist es ein Wecker der uns unsanft aus dem Schlaf rüttelt. Wir leben ein Leben, das durch die Uhr, einem künstlichen Rhythmus unterworfen ist. Wir müssen uns einer Zeiteinteilung unterwerfen, die die Gesellschaft durch die Arbeitsstruktur vorgibt. Jeder weiß wie schwer es ist, in der kalten Jahreszeit, wenn es draußen noch finster ist, um sieben Uhr aufzustehen. Dies entspricht oft nicht unserem eigenen Rhythmus, jedoch müssen wir uns anpassen. Schlimmer wird es noch, wenn wir einen voll gefüllten Terminkalender vor uns sehen, der den Rhythmus unseres Tagesablaufes bestimmt. Das kostet uns oft unsere ganze Kraft. Manchmal übertreiben wir es und leben über unsere Kraft und werden dann krank. So gesehen, kann ein ständig ungesunder Lebensrhythmus zu einem Bifurkationspunkt (Krankheit) führen, der uns zwingt, uns eine neue Richtung in unserem alltäglichen Leben zu überlegen.
„Wir beobachten das Rhythmische als Ordnungsweise in jener universellen Bewegungskraft, die ‚die Welt im Innersten zusammenhält‘. Es äußert sich als ursprünglich gegebenes Regulativ in der physikalischen und organischen Eigengesetzlichkeit alles Naturhaften. Es ist die Art und Weise, in der das Lebensgeschehen in jedem einzelnen Organismus oder organismischen System – es sei in Pflanzen, Tier oder Mensch – durch zyklisch (periodisch oder phasisch) gesteuerte Selbstbewegung sich erhält und erneuert. Dabei folgen die einzelnen, auch kleinsten Organismen keiner starren Bewegungsregel. Sie zeigen vielmehr die Fähigkeit, in immer größere Rhythmen verflochten, in diese hinein zu wirken und im Rahmen ihrer eigenen Spannweite sich auszubalancieren zugunsten eines immer größeren Bewegungsganzen. Diese Verhaltensweise ist das Kriterium für alles Organische. Sie repräsentiert geradezu das Organische und den Rhythmus als ein Urphänomen.“ (Erdmann, S. 12)
Rhythmus ist nicht statisches Hin- und Herpendeln. Rhythmus ist selbstähnliche Wiederholung, aber keine exakte Wiederholung. Dies wird am Beispiel des Herzschlags ersichtlich. Er folgt einem bestimmten Rhythmus. Störungen der normalen Verhältnisse in der Herzschlagdauer können in zwei Richtungen pathologische Folgen haben: Wenn der Herzschlag allzu periodisch wird, so kann das zu Herzversagen durch Stauung führen. Andrerseits verursacht ein allzu aperiodischer Rhythmus das Flimmern eines Herzanfalls. Der Rhythmus des Herzens schwankt also im Grenzbereich zwischen Ordnung und Chaos.
„Der Mensch stellt sich von der Geburt an dar als ein in Eigenbewegung befindlicher, vom zentralen Nervensystem ganzheitlich gesteuerter und zum Denken drängender Organismus.“ (Erdmann, S. 12)
„Es kommt hinzu, daß das Menschenwesen bis ins Geheimste auf eine rhythmische Ordnung hin angelegt ist. Es ist infolgedessen durch rhythmische Erscheinungsformen außerhalb seiner selbst in seinem sensomotorischen Bereich berührbar, ansprechbar und bestärkbar, denn es erfährt durch sie unbewußt eine Entsprechung zu seinen ureigenen Lebens- und Bewegungsbedürfnissen. “ (Erdemann, S. 12)
„Rhythmisch strukturierte Sinneseindrücke entsprechen den biologischen Grundgegebenheiten der Menschennatur und kommen ihren Entwicklungsbedürfnissen entgegen.“ (Erdmann, S. 12)
Der menschliche Organismus selber ist in diesem Sinne auch ein funktionierendes rhythmisches Bewegunsganzes. Die psychosomatische Funktionstüchtigkeit ist gewährleistet durch unendlich viele rhythmisch verlaufende, sich selbst regulierende und untereinander beeinflussende Teilfunktionen. … Der Gesamtorganismus wiederum ist angeschlossen an die ihn erhaltende Biosphäre und diese schließlich an die kosmischen Rhythmen oder Zyklen.
Im Körper selber laufen verschiedene Rhythmen ab, wie: Schlafen und Wachen. Aber der einzelne Körper ist wiederum eingebettet in die natürlichen Rhythmen der Natur wie: Winter und Sommer, Tag und Nacht.
Eine grundlegende Charakteristik des Lebens ist, daß Leben in gewissen Rhythmen verläuft. Der größte Rhythmus ist jener zwischen Geboren werden und Sterben müssen. Er wiederholt sich unaufhörlich in der Evolution. Aber auch der Rhythmus zwischen Tag und Nacht, der Rhythmus der Jahreszeiten, der Zyklus der Frau, aber auch verschieden kulturelle Feste wie Weihnachten und Ostern u.v.a.m. bestimmen unser Leben. Wir sind chaostheoretisch gesprochen, in verschiedenen Bereichen einem Grenzzykelattraktor unterworfen. Er verleiht uns Beständigkeit.
Die Wassertemperatur in Fließgewässern hängt überwiegend von der Höhenlage und der geographischen Breite ab. lm Sommer jedoch wärmen sich alle Gewässer zusehends auf, je nach Flußbreite, Uferbeschattung und Quellzuflüssen. Im Winter kühlen sie wieder ab. Breite Gewässer mehr als schmale. Es gibt jedoch auch tägliche Temperaturschwankungen, die vor allem im Sommer in kleinen Gewässern mit seichtem Wasserkörper und gering ausgebildeter Ufervegetation bis zu zehn Grad betragen können.
Wesentlich für die Strukturbildung ist die in gewissen Abständen immer wieder vorkommende Überschwemmung. Schwemmholz, Zweige, Äste und Stämme, die im Fliehgewässer dabei mittransportiert werden, führen zur Differenzierung des Strömungsmusters und erhöhen die Verzweigungsneigung des Gehirnes und bedingen damit insgesamt die Steigerung struktureller Vielfalt. Die dadurch gebildeten Strukturen werden von einer Vielzahl von Benthos- und Fischarten besiedelt. Ständige Zerstörung bestehender, bei gleichzeitiger Entstehung neuer Strukturen, ist wesentliches Merkmal dynamischer Fließgewässer. Schwemmholz lagert sich oft über die gesamte Flußbreite ab und stellt daher besonders in größeren Flüssen, ein wesentliches Strukturelement dar. Rhythmisch wiederkehrende Überschwemmungen sind letzten Endes wichtig für die Strukturbildung und für das Überleben von verschiedenen Lebewesen. Dadurch, daß Schwemmholz aus den Flüssen entfernt wird, Flußläufe begradigt und Kraftwerke gebaut werden, werden diese Rhythmen unterbrochen und die Lebewesen verlieren ihren Lebensraum.
Bei Flüssen mit geringer Breite stellen Ufergehölze ein wichtiges Regulativ für den Temperaturhaushalt dar. Werden sie z.B. aufgrund von Begradigungen entfernt, so genügen bereits Erwärmungen um wenige Grad Celsius um zum Ausfall einzelner Arten zu führen. Die natürliche Strukturierung der Kraut-, Strauch- und Baumschicht ist für die Lebensweise vieler Insekten überlebenswichtig. Ihr Lebensrhythmus anfangen von Paarung, Rastplätzen, Zeitspanne für die Flügelhärtung kann sich nur in diesen Bereichen abspielen. Mit der Zerstörung der natürlichen Flußläufe werden die verschieden ineinandergekoppelten Rhythmen gestört. Der Ausfall einer einzigen Art kann unabsehbare Folgen haben, da ja letzten Endes alle einzeln betrachteten Lebewesen mit ihrem Rhythmus mit allen anderen vernetzt sind. Ich denke hier an das Beispiel des Schmetterlingseffekts, kleine Veränderungen in den Rahmenbedingungen können sich durch Iteration so weit aufblähen, daß letzten Endes Chaos möglich wird.
Inhaltsverzeichnis
„Leben im menschlichen Sinne kann nicht asozial, es muß sozial sein. Leben in unserem Sinne wird durch den Dialog geschaffen.“ (R. Spitz, 1988, S. 23)
Unlängst saß ich in einem Cafe und wartete auf meinen Sohn. Drei junge Männer betraten das Lokal und setzten sich an einen Nachbarstisch. Sie bestellten. Dann nahm der erste sein Handy aus seiner Jackentasche und telefonierte. Die anderen mußten still sein, oder waren aus Höflichkeit still. Etwas später tat es ihm der andere junge Mann gleich und am Ende der dritte. Eifrig redeten sie jetzt alle. Aber nicht miteinander sondern jeder mit dem Telefonpartner am anderen Ende. Jeder kam sich sehr wichtig vor, das war ihren Mienen anzusehen. Dann bezahlten sie und gingen. Sie haben sich in der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes im Lokal nie miteinander unterhalten. Wie die Situation war, stellte sie sich mir als unwirklich dar. Da stellte sich mir die Frage: Welche Wege der Kommunikation haben wir bereits beschritten? Wie werden wir – als soziale Wesen – mit diesen neuen Anforderungen zurechtkommen?
Eine der wesentlichsten Aussagen für die Bedeutung menschlicher Kommunikation scheint mir die Aussage zu sein: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (Buber, S. 32)
In seinem Hauptwerk „Ich und Du“ bilden die beiden Grundworte „Ich-Du“ und „Ich-Es“ das Fundament seiner Aussagen. Diese beiden Grundworte bilden je eine Einheit. Das „Ich-Du“ entspricht, das „Ich-Es“ verletzt das dialogische Prinzip. „Grundworte werden mit dem ganzen Wesen gesprochen.“ (Buber, S. 7) Wenn Ich gesprochen wird, ist das Du oder Das Es mit einbezogen. Wer also Ich spricht, meint jeweils eines von den beiden. Er spricht dann nicht nur irgend ein Wort, sondern tritt in das Wesen des Wortes ein.
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ (S. 15) Durch das Du, das mir begegnet, werde ich. Aber es begegnet mir „von Gnaden“, ich kann es nicht erzwingen. Jede Beziehung ist erwählt Werden und Erwählen. Das Grundwort „Ich-Du“ kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Dann werde ich, wenn ich Du sage, zum Ich. Es bildet die Welt der Beziehungen. Ganz anders verhält es sich mit dem Grundwort „Ich-Es“.
„Aber die Es-Menschheit, das Innere imaginiert, postuliert und propagiert, hat mit einer leibhaften Menschheit, zu der ein Mensch wahrhaft spricht, nichts gemein.“ (Buber, S. 17) Wer Es spricht, meint nur ein Etwas. Ein Etwas kann daher nur sein neben einem anderen Etwas. Es ist nur dadurch, daß es an andere grenzt. Es gibt nur ein Es neben einem Es, ein Er neben einem Er und ein Sie neben einem Sie. Es gibt keine wirkliche Beziehung.
„Beziehung ist Gegenseitigkeit“. (Buber, S. 19) Buber fordert uns als Pädagogen an dieser Stelle heraus, wenn er sagt: „Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke. Unsere Schüler bilden uns, unsere Werke bauen uns auf.“ Das bedeutet, daß wirkliche Erziehung nur durch Beziehung geschehen kann. Erziehung ist deshalb nie einseitig. Wir wirken auf unsere Schüler, aber auch sie wirken auf uns.
Es werden damit Institutionen wie Krankenhäuser, Altersheime, Behindertenheime u.a. Institutionen in Frage gestellt. Der solchermaßen „separierte“ Mensch ist in seiner Freiheit sehr eingeschränkt. Er kann sein Du nur sehr schwer auswählen. Gerade in Krisensituationen braucht man aber Menschen, die wahre Begegnung möglich machen.
Der Mensch wird nur durch Begegnung zum Menschen und nicht dadurch, daß einer über den anderen verfügt und damit bestimmt, was für ihn gut ist. Buber sagt: „Wenn wir eines Weges gehen und einem Menschen begegnen, der uns entgegenkam und auch eines Wegs ging, kennen wir nur unser Stück, nicht das seine, das seine nämlich erleben wir nur in der Begegnung.“ (Buber, S. 77) Das bedeutet, daß wir als Pädagogen, Ärzte, Betreuer und Eltern letzten Endes nur nach unseren Möglichkeiten für unsere Mitmenschen Räume eröffnen können und Angebote machen können. Die Wahl, die jeder einzelne dann treffen wird, ist ihm/ihr selber überlassen, denn nur er/sie kann wissen was für ihn/sie richtig und wichtig ist.
„Das Du tritt mir gegenüber“, (Buber, S. 78) ich kann es nicht erzwingen. Natürlich ist es auch Illusion, daß jede Begegnung im Grundwort „Ich-Du“ verhaftet bleibt. In diesem Sinn läßt sich Beziehung immer nur für kurze Zeit verwirklichen. Dann kann eine Beziehung in das Grundwort „Ich-Es“ übergehen. Der andere wird gewissermaßen zum Gegenstand, verdinglicht. „Ich-Du“ ist alles Bedeutende im Leben und doch läßt sich nicht dauerhaft in ihm leben. Es ist nur vorübergehend. „Das aber ist die erhabene Schwermut unseres Loses, daß jedes Du in unserer Welt zum Es werden muß. So ausschließlich gegenwärtig es in der unmittelbaren Beziehung war; […] Der Mensch, der eben noch einzig und unbeschaffen, nicht vorhanden, nur gegenwärtig, nicht erfahrbar, nur berührbar war, ist nun wieder ein Er oder eine Sie, eine Summe von Eigenschaften, ein figurhaftes Quantum geworden.“ (Buber, S. 21)
Feuser legt auf diesen philosophischen Ansatz in seinem Menschenbild besonderes Gewicht. Darauf werde ich im Folgenden eingehen.
Daß der Mensch als eine Einheit aus Biologischen, Psychischem und Sozialem betrachtet werden, ist aus dem Umbruch, sowohl in der Naturwissenschaft als auch in der Philosophie entstanden. Die Tragweite dieses Paradigmenwechsels wird erst heute langsam sichtbar. Ein neues Denken, Erkennen und Verstehen wird gefordert, wenn Leben als ständiges „Werden“, als Ent-wicklung von der Konzeption bis zum Tod betrachtet wird.
Der Mensch hat einen Körper und eine Psyche mit denen er wahrnehmen, empfinden, denken und handeln kann. Dadurch wird es uns möglich, uns miteinander in Beziehung zu treten und uns sozial zu verhalten. Diese drei Ebenen sichern unsere menschliche Existenz. Sie stellen eine gewisse Hierarchie dar – biologische, psychische und soziale Ebene. Die jeweils höhere Ebene ist zwar die momentan führende aber sie braucht dazu die jeweils tieferen Ebenen. Unter Berücksichtigung des „System Mensch“ als Ganzes ist zu unterstreichen, daß jede Eigenschaft des Systems auf allen Ebenen repräsentiert sein muß, allerdings in unterschiedlicher Form. Wir können den Menschen nicht mehr auf eine Ebene reduzieren. Auch wenn auf einer Ebene eine für uns sichtbar gewordene Beeinträchtigung auftritt, stellt diese Unterteilung lediglich ein theoretisches Hilfswerk dar und es sind immer alle Ebenen betroffen. Die Gesamtheit des Systems bildet den Möglichkeitsraum des Menschen, der wiederum eingebettet ist in ein raum-zeitliches Kontinuum.

Abb. l3: Bio-psycho-soziale Einheit Mensch (Feuser 1995, S. 91)
Unter diesen Voraussetzungen fordert Feuser in besonderer Weise unsere Dialogfähigkeit heraus. Er arbeitet mit Patienten, die uns in unserer üblichen Sichtweise als „verstummt“ erscheinen. Es handelt sich u.a. um Patienten im komatösen Zustand. Sinnlos scheint jedes Gespräch mit ihnen, wir erhalten keine der erwarteten Antworten. Es liegt jedoch an unserer Art des Betrachtens, daß wir ihre Kommunikationsfähigkeit nicht wahrnehmen. Bieten wir dem Schwerkranken Dialog an, so erhalten wir Antwort. Allerdings äußert sich sein Beitrag auf einer anderen Ebene. Wir müssen lernen, auf seinen Herzschlag, seine Hirnfrequenz oder den unterschiedlichen Spannungszustand seiner Haut zu achten. Können wir diese Äußerungen sinnvoll interpretieren, ist es möglich, einen Dialog mit dem Patienten aufzubauen.
Dazu fällt mir das Beispiel meiner eigenen Kinder ein. Als sie zur Welt kamen, lagen sie klein und hilflos zappelnd da. Weit entfernt von jeder uns üblicherweise vertrauten Kommunikation des Sprechens. Dennoch würde es keiner absprechen, daß Dialog mit diesen kleinen Wesen durchaus möglich ist. Schon bevor das Kind schreiend seine Äußerungen mitteilt, sieht man an seiner Art, sich zu bewegen, seiner Mimik, der Farbe seiner Haut, daß eine Äußerung bevorsteht, und nicht selten weiß man schon von vornherein, welche kommen wird. Das Kind bietet den Dialog von sich aus an und ich als Mutter antwortete und umgekehrt. Niemand würde sagen, daß diese Art der Kommunikation zwischen Mutter und Kind eine nicht vorhandene sei, obwohl die sprachliche Ebene zu Beginn eine sehr untergeordnete Rolle spielt.
Um auf die komatösen Patienten zurückzukommen, heißt dies, daß wir durchaus in der Lage sind in Dialog zu treten, wenn wir bereit sind, unsere übliche Art der Wahrnehmung auszuweiten. „Aufgabe des Dialogpartners (Arzt, Therapeut, Pädagoge) ist es, den Schlüssel zum richtigen Verständnis der Äußerungen zu suchen,“ wie Burtscher in seiner Diplomarbeit schreibt. Unser eigenes Unvermögen darf nicht zum Unvermögen des Patienten werden. Es ist nicht sein Unvermögen, sondern seine besondere Fähigkeit, in diesem Zustand zu kommunizieren. Wesentliche Hinweise liefert uns die jeweilige Lebensgeschichte und der Lebenszusammenhang des Betreffenden. (Burtscher, S. 26)
„In schweren Fällen der Beeinträchtigung, denken wir z.B. an eine schwere Hirnschädigung (z.B. Koma, apallisches Syndrom), kann die psycho-soziale Ebene in ihrer führenden Rolle blockiert sein bzw. dies partiell auch eingebüßt werden. Dann wird die biologische Ebene verstärkt in die rührende Rolle der Selbstorganisation des Systems einbezogen. Solange der betroffene Mensch lebt – und sei es mit Hilfe apparativer Unterstützung -, realisiert nun diese Ebene in Kooperation mit den noch möglichen Funktionen der anderen Ebenen auf ihre Weise und mit ihren Mitteln(!) alle Funktionen, die für die Aufrechterhaltung der Lebensprozesse unter den eingetretenen, neuen ‚Rand‘-Bedingungen erforderlich sind; […] Systemeigenschaften, die für das ‚Leben‘ grundlegend sind, wesentlich die zur Führung des ‚Dialogs‘ mit der Umwelt, treten auf jeder Ebene auf, haben aber auf jeder Ebene sozusagen ihr eigenes Gesicht. Oder: Eine dominant auf der psycho-sozialen Ebene erforschte und entsprechend begrifflich gefaßte Systemkomponente tritt auf der biologischen Ebene in völlig anderer Weise in Erscheinung, leistet aber auf dieser in gleicher Weise wie auf höherer Systemebene die für das gesamte System unter seinen Randbedingungen fundamental bedeutsame Funktionen des Dialogs.“ (Feuser 1995, S. 90, 92)
Alle drei Ebenen – biologische, psychische, soziale Ebene – machen das ganze System aus. Wir können sie zwar als Theoretisches Konstrukt voneinander abgrenzen, dennoch stehen sie innerhalb des Systems in einer engen Verflochtenheit, Diese Theorie entspricht dem chaostheroetischen Ansatz, der mit dem Beispiel des Schmetterlingseffekts, der Rückkoppelung oder Iteration besagt, daß wir letzten Endes nie wissen, was tatsächlich in einem System stattfindet, wir werden nur das sehen können, was uns das betreffende System „erlaubt“ zu sehen. Wir können unsere Art der Betrachtung ändern und dürfen nicht vom einzelnen Bild, das sich uns bietet, auf das gesamte System schließen. Wir müssen lernen, unseren Wahrnehmungsspielraum zu vergrößern, damit wir andere Formen des Dialogs, der Interaktion und Kommunikation sowohl wahrnehmen, als auch anbieten können. „Keine noch so schwere Beeinträchtigung verunmöglicht den Dialog, die Interaktion und Kommunikation“, wie Feuser an anderer Stelle schreibt. Oder wie Watzlawick sagt: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Allerdings muß man sich um den richtigen Code bemühen. Watzlawick weist darauf hin, daß es letzten Endes darum geht, eine gemeinsame „Sprache“ zu finden, damit Kommunikation gelingen kann und nicht im Empfänger einer Information Ungewißheit, Mißverständnisse und daraus resultierend Angst hinterläßt.
„Störung der Wirklichkeitsanpassung kann von Zuständen leichter Verwirrung bis zur akuten Angst reichen, da wir Menschen, wie alle anderen Lebewesen, auf Gedeih und Verderb von unserer Umwelt abhängen und sich die Abhängigkeit nicht nur auf die Erfordernisse des Stoffwechsels, sondern auch auf hinlänglichen Informationsaustausch bezieht. Dies trifft vor allem auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu, wo ein Höchstmaß an Verstehen und ein Mindestmaß an Konfusion (Verwirrung, Verworrenheit, Durcheinander) für erträgliches Zusammenleben wichtig ist.“ (Watzlawick, S. 13)
„Denn nicht von allem absehen, heißt in die reine Beziehung treten, sondern alles im Du sehen; nicht der Welt entsagen, sondern sie in ihren Grund stellen.“ (Buber, S 80)
Rist-Grundner, Familientherapeutin und Sozialarbeiterin, meinte bei einem Seminar über Trauerbegleitung: „Der Mensch ist grundsätzlich ein soziales Wesen. In Extremsituationen, – wie dem Sterben eines lieben Angehörigen – , friert seine Fähigkeit zum Dialog oft grundsätzlich ein. Es ist unsere Aufgabe, ihm in dieser Situation unseren Dialog anzubieten.“ (Vortrag, Trauerbegleitung, Breitenwang, 30.3.98)
René A. Spitz erkannte bereits in den fünfziger Jahren die Wichtigkeit des Dialogs für die kindliche Entwicklung. Er stellte fest, daß der Dialog immer ein wechselseitig stimulierender Rückkoppelungsprozeß ist, bei dem die emotionale Seite eine große Rolle spielt.
„Es ist ein Dialog des Tuns und Reagierens, der in Form eines Kreisprozesses innerhalb der Dyade vor sich geht, als fortgesetzter, wechselseitig stimulierender Rückkoppelungsstromkreis.“ (Spitz, 1988, S. 14) Spitz nennt diese Form der Interaktion einen Dialogvorläufer. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Emotionen. Dieser Mutter-Kind-Dialog ist aber kein repetiver (sich wiederholender) Prozeß von Aktion und Reaktion. „Im Gegenteil, die psychischen Reaktionen, die in der Mutter durch die Initiative des Kindes und die beim Kinde durch das ausgelöste Verhalten der Mutter erzeugt werden, bewirken immer neue Konstellationen von zunehmender Komplexität. Bekanntlich sind es Konstellationen und Strukturen, die sich aus der Energieverschiebung ergeben. Jeder dieser Kreisprozesse mündet in irgendeine Befriedigung oder Versagung und hört dann auf. Es bleiben jedoch Spuren davon in der Psyche und im Gedächtnis beider Partner erhalten. Diese Spuren modifizieren dann den nächsten Kreisprozeß schon zu Beginn in der Form, dem Ablauf oder dem Ziel, das er erstrebt, so daß der Dialog dauernd an Komplexität gewinnt.“ (Spitz, 1988, S. 14)
Die Bedeutung des Dialogs für den Menschen läßt sich gar nicht hoch genug einschätzen. Er führt letzten Endes dazu, daß das heranwachsende Kind lernt, mit seinen libidinösen und aggressiven Trieben umzugehen, aber auch sein Angstpotential in erträglichem Maß zu halten. Spitz zeigt dies anschaulich an seinem Beispiel der „Surrogatmütter“.
Er bezieht sich auf ein Experiment von Harlow in dem er die Aufzucht von Affen mit Ersatzmüttern aus Draht und Frotteestoff ausführlich erörtert. Die Folgen davon sind. daß die mit diesen Surrogatmüttern aufgezogenen Affen weder spielen noch Sozialbeziehungen aufnehmen können. Sie unterliegen unkontrollierbarer Angst und Ausbrüchen heftiger Erregung, Feindseligkeit und Zerstörungswut. Wenn diese Affen erwachsen sind, nehmen sie keine Sexualbeziehung auf und zeigen überhaupt keinerlei sexuelles Verhalten. (Spitz, 1988, S. 13)
Eine wichtige Phase in der Entwicklung des Kindes ist jene, in der es lernt, belebte Objekte von unbelebten zu unterscheiden, wobei der Umgang mit den unbelebten Dingen in eine Sackgasse führt. „Beim belebten Partner dagegen ist die Rückkoppelung bilateral und für jeden der beiden Partner verschieden. […] immer neue, immer andere Antworten entstehen innerhalb des Dialogs, […] An der starren Reaktionslosigkeit erkennt also das Kind die nichtbelebten Objekte.“ (Spitz 1988, S. 16) Die Dinge dienen zwar dazu, daß der Aggressionstrieb ungebremst abgeführt werden kann, aber das Ergebnis ist letzten Endes unbefriedigend. „Dagegen eignet sich der lebendige Partner mehr zur Abfuhr des libidinösen Triebes. Denn er liefert die unerschöpflichen Gelegenheiten für den Dialog, und gleichzeitig bietet er dem Kind nicht nur einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Abfuhrweg libidinöser – und auch aggressiver – Energie, sondern eröffnet ihm durch eben diesen Dialog Wege für die Erweiterung dieser Abfuhr und erlaubt ihm gleichzeitig, die Früchte der affektiven Befriedigung zu ernten.“ (Spitz 1988, S. 15f) Der Dialog spielt also eine wichtige Rolle bei der Triebbefriedigung. Aber gleichzeitig lernt das Kind dadurch seine Angst und Hilflosigkeit zu vermindern.
Spitz unterstreicht die Wichtigkeit des Dialogs dadurch, daß er ihm eine wichtige Aufgabe nicht nur für das Sozialleben, sondern für die gesamte Menschheit einräumt. „Ich betrachte also den Dialog als die Quelle, den Beginn der artspezifischen Anpassung.“ Denn am Beispiel der Affen die mit den Surrogatmüttern großgezogen wurden, zeigte
sich die Verarmung der Persönlichkeit des Individuums und schließlich, durch Aufhören des Sexualbetätigung die Vernichtung der Art. „Der Mensch, dem man als Säugling den Dialog vorenthält, wird zur leeren Hülle, geistig tot, ein Anwärter auf Anstaltsbetreuung. Leben im menschlichen Sinne kann nicht asozial, es muß sozial sein. Leben in unserem Sinne wird durch den Dialog geschaffen.“ (Spitz, 1988, S. 23)
„Entwicklung über die Lebenspanne geschieht in Auseinandersetzung zwischen der Person und ihrer Umwelt, wobei sich Veränderungen auf beiden Seiten wechselseitig bedingen können.“ (von Lüpke/Voß, S. 12)

Abb. l4: Strukturkoppelung des selbstorganisierenden Sytems Mensch (Feuser 1996, S. 8)
„Wer Kontexte sucht, auswählt, verändert oder schafft, sich beispielsweise in eine freizeitkulturelle Szene begibt, setzt sich Anstößen, Herausforderungen oder Gefahren aus, die für die künftigen Entwicklungschancen bedeutsam sind, etwa weil sie Selbstbewußtsein vermitteln oder Werthaltungen befördern. In diesem Sinne gestaltet Person, in Auseinandersetzung mit der Umwelt, häufig also mit Personen, ihre eigene Entwicklung.“ (von Lüpke/Voß, S. 12)
Es geht immer um das Wechselspiel von Person und Kontext bei Entwicklungsprozessen. Entwicklung wird als lebenslanges Geschehen verstanden, das die Zeit von der Konzeption bis zum Tod umfaßt, während der eine beständige Wechselwirkung von biologischen und ökologischen Einflüssen erfolgt.
Spitz untersuchte in den Jahren 1945 und 1946 Kinder die in Säuglingsheimen lebten. Er stellte fest, daß durch den fehlenden Dialog die Kinder entweder in eine anaklytische Depression verfielen oder sie litten unter Hospitalismus.
Die folgende affektive Zufuhr führte dazu, daß die Kinder die zuerst fröhlich waren, mit der Zeit immer weinerlicher wurden. Schließlich verweigerten sie jeden Kontakt. Außerdem verloren sie häufig an Gewicht und litten oft unter Schlaflosigkeit. Alle Kinder zeigten außerdem eine wachsende Auffälligkeit für hinzutretende Erkältungen. Später kam es dann anstelle der Weinerlichkeit zu einem starren Gesichtausdruck, Kontaktaufnahme wurde dann unmöglich. Mußten die Kinder länger als drei bis fünf Monate ihre Mutter entbehren, ohne daß man ihnen einen annehmbaren Ersatz bot, trat eine weitere Verschlechterung ein. Allerdings können die Kinder von diesem Zustand genesen, wenn innerhalb von fünf Monaten eine verläßliche Beziehung geboten wird. Spätere Auswirkungen weiß man nicht. Spitz nennt diesen Zustand „anaklytische Depression“ um sie vom Krankheitsbild der Erwachsenendepression zu unterscheiden.(vgl. Spitz, S. 280 ff.)
Dauert die Trennung von der Mutter jedoch länger als fünf Monate, ändert sich die Symptomatik. Es kommt zu einem zunehmend schweren Verfall, der mindestens zum Teil irreversibel ist. „Das Fehlen dieser mütterlichen Fürsorge kommt einem emotionalen Verhungern gleich. Wir haben gesehen, daß dieses einen fortschreitenden Verfall herbeiführt, der sich auf die ganze Person des Kindes erstreckt. Dieser Verfall manifestiert sich zuerst in einer Stockung in der psychischen Entwicklung des Kindes; dann setzen psychische Funktionsstörungen ein, mit denen somatische Veränderungen einhergehen. Im nächsten Stadium führt dies zu gesteigerter Infektionsanfälligkeit und schließlich, wenn der mangels an affektiver Zufuhr bis ins zweite Lebensjahr hinein andauert, zu einer auffallenden Erhöhung der Sterblichkeitsquote.“ (Vom Säugling zum Kleinkind, S. 292) Spitz hat dieses Syndrom unter dem Begriff „Hospitalismus“ zusammengefaßt.
Umgekehrt kann es jedoch auch zu einer Reizüberlastung kommen. Es handelt sich dabei um eine „falsch“ verstandene Liebe der Mutter. Es kommt zu einer affektiven Überversorgung durch die Mutter. Spitz nennt diesen Faktor „emotionale Überforderung“. Schuld daran sind meist ungelöste Probleme der Eltern, wie verdrängte Aggression, Schuldgefühle, narzißtische Bedürfnisse usw. Dieses Fehlverhalten führt zu einer Erscheinung, die Spitz „psychotoxisch“ nennt. Das noch ungenügend entwickelte Wahrnehmungssystem des Kleinkindes wird mit Reizen überlastet. Seine psychische Organisation kann mit der Menge und der Qualität der Gefühle noch nicht umgehen. Da diese Art des Dialogs nicht verarbeitet werden kann kommt es zu Unlust, Frustration und Angst. Schritt für Schritt führt das zum Zusammenbruch der Kommunikation. Der Dialog entgleist. (Spitz, S. 83f)
Feuser führt als weiteres Beispiel der Dialogentgleisung u.a. auch Stereotypien (S) und Selbstverletzende Verhaltensweisen (SVV) an, die oft bei hochgradig sehr lange hospitalisierten Menschen auftreten. Dabei macht sich als Folge der schwerwiegenden Isolation der Mensch zum Objekt seiner eigenen Tätigkeit. Der Mensch kann dann als Folge der Isolation keine Interaktion mehr nach außen aufnehmen und kompensiert diese durch rhythmisches Schaukeln (S) oder rhythmische Schläge (SVV) gegen sich selber. Dialog nach außen ist nicht mehr möglich. Diese Isolation kann letzten Endes bis zum Tod führen.
Neue Techniken bringen für den Menschen neue Herausforderungen mit sich. Besonders die Form der Dialogführung scheint mir zur Zeit herausgefordert zu sein.
Zu Beginn dieses Kapitels erzählte ich das Beispiel der drei jungen Männer mit ihren Handys. Sie redeten nicht miteinander und doch sprach jeder mit einem Partner der nicht körperlich anwesend war. Kinder sollen der Werbung entsprechend mit Kinder – Handys versorgt werden. Die Werbung spielt dabei mit den Ängsten der Eltern. Sie sollen ihr schlechtes Gewissen bei Nichtanwesenheit beruhigen. Jeder ist jederzeit überall zu erreichen. Wir können uns Gesprächspartner aussuchen ohne sie sehen zu müssen. Mit unserem Gegenüber brauchen wir nicht mehr zu kommunizieren. Ein anderes Beispiel modernder Technik ist das Internet. Via Computer ist man damit in Minutenschnelle überall auf der Welt. Online werden wichtige Geschäfte erledigt. Die Bedeutung für den Weltmarkt ist noch nicht abzusehen. da immer mehr Menschen zur selben Zeit über dieselben Informationen verfügen können. Unsere Soziale Dimension gilt es neu zu überdenken. Online werden neue Menschen kennengelernt und Partner gesucht. Glaubt man verschiedenen Medienberichten, so verbringen viele Leute ihre gesamte Freizeit kommunizierend vor dem Computer. Entsetzt horchen wir auf, wenn darüber berichtet wird, daß immer mehr Menschen den laufenden Pornodarstellungen, insbesondere mit Kindern, über das Internet folgen.
Wir sehen uns einer neuen Technik gegenüber, deren Wirkung auf unsere Dialog- und Kommunikationsfähigkeit noch nicht abzusehen ist.
Allgemeine Systemtheorie (fachübergreifend): Der Versuch eines formalisierten wissenschaftlichen Ganzheitsdenkens, das gemeinsame Gesetzmäßigkeiten in physikalischen, biologischen und sozialen Systemen findet. Die allgemeine Systemtheorie wurde in den 30er Jahren von dem österreichischen Biologen Ludwig von Bertalanffy begründet, der sich mit dem damals vorherrschenden Reduktionsimus auseinandersetzte. Beim Studium biologischer Zellen fand von Bertalanffy viele Eigenschaften und Funktionen, die auch für Systeme allgemein gelten mußten: Input, Umsetzung und Output von Stoff, Energie und Information, Differenzierung und Integration, homöostatisches Gleichgewicht und harmonische Einpassung in die aus komplexen Systemen bestehende Hierarchie des Organismus. Man nahm an, daß man Prinzipien, die man in einer Art von System festgestellt hatte, auch auf andere Systeme anwenden konnte. Hierzu gehört auch die Beschreibung von Selbstregulierung und Rückkoppelung, die man aus der Kybernetik kennt. (Raven, S. 9)
Attraktor (Physik): Jedes dynamische System hat die Tendenz, sich diesem Zustand zu nähern (von engl. attract: anziehen)
Autopoiese (Biologie): Bedeutet Selbsterschaffung: Im engeren Sinn die minimale Eigenschaft, die ein System besitzen muß, um als „lebend“ definiert werden zu können. Im weiteren Sinne die Gesamtheit von Prozessen in einem geschlossenen Netzwerk, durch die ein biologisches System ständig seine Bestandteile wiederbildet und seine Identität bewahrt. Das Wort wurde von dem chilenischen Biologen Humberto Maturana und seinem Schüler Francisco Varela im Jahre 1973 geprägt. (von gr. autos. selbst + poiein: schaffen) (vgl.Raven, S. 15)
Bifurkation (Physik): Ein kritischer Punkt in der Entwicklung eines physikalischen oder mathematischen Systems, von dem aus das System einem von zwei oder mehreren möglichen Wegen folgt. (lat. bis: zwei + furca: Gabel). In einem physikalischen System zeigt sich Bifurkation dadurch, daß der Zustand des Systems von einer Möglichkeit zur anderen wechselt. Bifurkation bedeutet eigentlich „Gabelung“; diese Bedeutung weist darauf hin, daß die Zustandswechsel oft dadurch geschehen, daß der Weg des Systems durch den Phasenraum sich in zwei mögliche Bahnen gabelt. (vgl. Raven, S. 19)
Brüsselator (Thermodynamik): Ein mathematisches Modell zur Vorhersage des Wechsels zwischen Stabilität und Instabilität chemischer Prozesse mit vielen einander beeinflussenden Komponenten. Das Modell wurde von einer Gruppe von Forschern unter Leitung des Chemikers Ilya Prigogine konstruiert und ist nach dem Heimatort der Gruppe, Brüssel, benannt. Es umfaßt Entwicklungsregeln für dissipative Strukturen unabhängig von ihrer „Substanz“, also unabhängig davon, ob es sich um die Entwicklung von chemischen Flüssigkeiten, Städten oder Volkswirtschaft handelt. (vgl. Raven, S. 24)
Chaos (Physik): Unvorhersagbares Verhalten in Systemen, die deterministischen Gesetzen unterworfen sind.
dissipative Struktur (Physik): Eine komplexe Struktur, die entstehen kann, wenn Energie durch ein System fließt. Die Bezeichnung stammt von dem belgischen Chemiker Ilya Prigogine. Bringt man ein System aus seinem thermischen Gleichgewicht, indem man ihm Energie zuführt, erhöht sich der Energiefluß durch das System, und es gibt Wärme an seine Umgebung ab (engl. dissipate: zerstreuen) (vgl. Raven, S. 37)
Dreikörperproblem (Physik): Die Frage, ob die Entwicklung eines aus drei Körpern, die sich gegenseitig durch ihre Scherkraft beeinflussen (z.B. drei Planten), bestehenden Systems von der klassischen Mechanik vorhergesagt werden kann. Diese Frage wurde von dem französischen Mathematiker. Physiker und Philosophen Henri Poincaré mit einem Nein beantwortet.
Erkenntnistheorie (Philosophie): Der Teil der Philosophie, der sich mit den Bedingungen dafür beschäftigt, wie man wahre Erkenntnis der Welt erreicht (auch Epistemiologie genannt). (Raven, S. 53)
Evolutionstheorie (Biologie): Diese Theorie beschäftigt sich mit der andauernden Entwicklung neuer Organismen aus existierenden seit dem Beginn des Lebens vor gut 3,6 Milliarden Jahren (von lat. ex: aus, volvere: rollen).
Feigenbaum Diagramm (Mathematik, Physik): Eine in den 70er Jahren von dem amerikanischen Physiker Mitchell Feigenbaum entdeckte Darstellung des Übergangs von Ordnung zu Chaos. Sie hat die Form eines Baums, dessen Stamm sich mehrmals teilt (daher wird sich auch als „der Feigenbaum“ bezeichnet). Feigenbaums Diagramm wurde bei der Untersuchung universeller Eigenschaften von Chaos entdeckt. (Raven, S. 58)
Fraktal (Mathematik, Physik): Eine besonders „zerfranste“ geometrische Figur, deren Form sich in immer kleinerem Maßstab wiederholt, wenn man näher an sie herangeht, und die man mit Hilfe einer nicht-ganzzahligen (fraktalen) Dimension beschreiben kann. Der Begriff wurde 1975 von dem in Polen geborenen Mathematiker Benoit Mandelbrot zur Beschreibung einer Klasse von geometrischen Figuren mit bruchzahliger Dimension konstruiert. (Raven, S. 65)
implizite Ordnung (Physik): Eine Form von Ordnung, bei der Information über die Gesamtheit schon in den Teilen dieser Gesamtheit vorhanden ist und die die tiefsten Schichten der Wirklichkeit charakterisiert. Der englische Ausdruck implicate wurde um 1970 von dem amerikanischen Physiker David Bohm gebildet (von lat. plicare: falten; vgl. plissiert). (Raven, S. 100)
Irreversibilität (Physik): Ein Prozeß ist irreversibel, wenn er nicht „umgedreht“ werden kann, d.h. wenn seine Entwicklung in die Zukunft hinein sich grundsätzlich von der unterscheidet, auf die man rückblickend schließen kann (lat. in: nicht + vertere. umkehren, umdrehen). (Raven, S. 106)
Komplexität (Physik, Mathematik, Biologie): Der Umstand, daß etwas kompliziert, schwer zu durchschauen ist (von lat. com: zusammen + plectere: flechten). Ein Forschungszentrum in den USA, das Santa Fe Institut in New Mexiko, mit Forschern wie Gell-Mann, A.S. Perelson, Stuart A. Kauffman und Christopher G. Langton, trugen zur Entwicklung eines neuen interdisziplinären Forschungsfeldes bei. Hier werden Forschungsansätze aus der Physik, u.a. Chaosforschung, Computerwissenschaft und künstliches Leben, zur Beschreibung komplexer Systeme eingesetzt. Es handelt sich nicht um eine zusammenhängende universelle Theorie über komplexe Systeme, sondern eher um eine generelle physikalisch-mathematische Betrachtung der Formen von spontaner Bildung geordneter Muster, die in den Gebieten vorkommen, aus denen ‚complex systems research‘ Beispiele beziehen: Wirtschaft, Verkehrsplanung, Zellbiologie, Immunologie, Evolutionstheorie, Thermodynamik und Theorie über die Entstehung der Sprache. (Raven, S. 120f)
Kybernetik (Ingenieurwissenschaft): Das Studium sich selbst regelnder Prozesse, in den 40er Jahren entwickelt und benannt (nach gr. kybernetes: Steuermann) von dem amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener. (vgl. Raven, S. 137)
Lorenz-Attraktor (Physik): Ein besonders stabiler, chaotischer Zustand, in dem ein dynamisches System sich befinden kann. Er wurde 1960 von dem amerikanischen Meterologen Edward Lorenz entdeckt. Der Lorenz-Attraktor hatte große wissenschaftliche Bedeutung, da es sich um den ersten fraktalen Attraktor handelte, den man beschreiben konnte. Der Lorenz-Attraktor stellt eine eine Gruppe ausgewählter Wege dar, die sich schrittweise dem Attraktor nähern, bei dem es sich um einen großen, dreidimensionalen Fraktal im Phasenraum handelt. (vgl. Raven, S. 141f)
Mandelbrot-Menge (Mathematik): Eine 1979 von dem in Polen geborenen Mathematiker Benoit Mandelbrot beschriebene, besonders berühmte fraktale Menge.
natürliche Selektion (Evolutionsbiologie): Der Umstand, daß die Natur im Existenzkampf jene Individuen selektiert oder ‚auswählt‘, die am besten angepaßt sind. Dies wird als die primäre Triebkraft der Evolution betrachtet. Darwin meinte, daß besser angepaßte Organismen mit komplexeren Strukturen in der Natur auf folgende Weise entstehen können: In einer Population unterscheiden sich die Organismen zufällig in einer Reihe erblich bestimmter Merkmale (Genotypen). (Raven, S. 158)
nicht-linear (Mathematik-Physik): Eine Eigenschaft einer besonderen Klasse von schwer lösbaren Gleichungen, die physikalische Phänomene beschreiben, bei denen – vereinfacht gesagt – eine kleine Ursache eine große Wirkung haben kann. (vgl. Raven, S. 168)
Ökosystem (Ökologie): Ein aus den Organismen eines Lebensraums (z.B. See, Wald) im Zusammenspiel mit ihrer physikalisch-chemischen und biologischen Umgebung bestehendes System (von gr. oikos: Haus). Ökologen versuchen u.a. zu verstehen, warum bestimmte Arten von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen in bestimmten Ökosystemen auftreten. (vgl. Raven, S. 172)
Paradigma (Philosophie): Das Verständnis der Wirklichkeit und ihrer Erforschung, das einer Mehrzahl von Forschern einer bestimmten Wissenschaftsdisziplin in einer bestimmten Periode gemeinsam ist (gr. pardeigma: Bedeutungsmuster, Vorbild). Der Begriff wurde 1962 von dem amerikanischen Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn lanciert. (vgl. Raven, S. 174)
Phasenraum (Physik, Mathematik): Ein abstrakter Raum, der zur Abbildung eines dynamischen Systems und zur Berechnung seiner Entwicklung dient.
Phasenübergang (Physik): Die Veränderung der Materie von einer Zustandsform zu einer anderen, z. B. Verdampfung.
Quantensprung (Physik): Niels Bohr führte 1913 diesen Begriff zur Erklärung des Aufbaus des Wasserstoffatoms ein. Er bedeutet ursprünglich den „Sprung“, durch den ein Elektron seinen Zustand von einer „Schale“ um den Atomkern zu einer anderen verändert. Die Erklärung von Bohr löste die frühere Auffassung ab, nach der Elektronen auf allen möglichen Bahnen um den Atomkern kreisen. Bohr wies nach, daß nur ganz wenige, bestimmte Bahnen möglich sind, die sogenannten Schalen. Ein Elektron springt von einer Schale zu einer anderen, ohne sich zu irgendeinem Zeitpunkt in einem Zwischenzustand zu befinden. Diesen Sprung, den man korrekt als einen Zustandswechsel betrachten muß, bezeichnet man als Quantensprung, da er unter Abstrahlung oder Aufnahme einer gewissen Energiemenge, einem sogenannten Quant, z. B. einem Lichtteilchen, geschieht. … Im übertragenen Sinn bezeichnet ‚Quantensprung‘ im alltäglichen Sprachgebrauch jede radikale Veränderung, z. B. die einer Denkweise (vgl. Paradigmenwechsel)
Randbedingungen (Mathematik, Physik, Erkenntnistheorie): Die Bedingungen, die von den möglichen Entwicklungen eines Systems genau auf die realisierbaren begrenzen (engl. boundry conditions). Physik: Die geometrischen Grenzen die einem physikalischen System für dessen Dynamik gesetzt werden. Z. B. bestimmt die Größe einer Wasserwanne die Größe der stehenden Wellen die in ihr entstehen können. Michael Polany rührte Randbedingungen im weiteren Sinn als Bezeichnung für jede Begrenzung der möglichen Realisierungen eines Systems ein. Ein Organismus hat eine bestimmte Struktur, und diese hat die Funktion von Randbedingungen für die biochemischen Prozesse, die im Organismus stattfinden. Dabei handelt es sich um wesentlich weniger biochemische Prozesse, als eigentlich möglich wären. (vgl. Raven, S. 194)
Reduktionismus (Philosophie): Die Auffassung, daß die Beschreibung jedes Phänomens von dessen elementarsten Bestandteilen ausgehen kann und muß.
rekursiv (Mathematik, Informatik): Etwas, das ‚wiederkehrend‘ benutzt wird, z. B. grammatische Regeln für einen Satz, der immer länger werden kann, indem man eine Regel über die Hinzufügung eines Nebensatzes benutzt, der wiederum Nebensätze haben kann, … (lat. cursus: Lauf).(vgl. Raven, S. 195f)
Relativitätstheorie (Physik): Gemeinsame Bezeichnung für zwei Theorien über Zeit und Raum, die Einstein 1905 bzw. 1915 veröffentlichte.
Rückkoppelung (Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft): Ein Teil des Outputs eines Systems wird als Input an das System zurückgeschickt (engl.: feedback) und beeinflußt dadurch wiederum das Verhalten des Systems. (vgl. Raven, S. 201)
Schmetterlingseffekt (Physik): In der Chaostheorie der Umstand, daß eine kleine Ursache große Wirkungen haben kann, z. B. daß der Flügelschlag eines Schmetterlings an einem Ort der Welt an einem anderen Ort zu einem Orkan führen kann, (vgl. Raven, S. 201)
Selbstähnlichkeit (Mathematik): Das Phänomen, daß ein Ding (z.B. ein Blumenkohl) sich selbst unabhängig vom Vergrößerungsgrad ähnelt.
Selbstorganisation (Physik, Biologie): Das spontane Entstehen von Ordnung, erkennbar an beobachtbaren Strukturen in ansonsten ungeordneten materiellen Systemen.
Struktur (Philosophie): Dieser klassische Begriff hat durch die Arbeiten des französischen Philosophen Jean Petitot neue Aktualität gewonnen. Petitot benutzte das Wort Struktur als Bezeichnung für all die formmäßigen Phänomene, die sich nicht auf einzelne Elemente reduzieren lassen. Von den Gedanken Kants ausgehend, sieht Petitot es als möglich an, strukturelle Phänomene als objektiv existierend zu betrachten – parallel zu, jedoch nicht identisch mit der klassischen physikalischen Objektivität physikalischer Phänomene. Eine neue Wissenschaft würde dann Struktur in all ihren verschiedenen Manifestationen studieren können, und Petitot stellt sich vor, daß Fragen der Form in der Makrophysik, der Biologie, der Gestalttheorie, der Semiotik, der Linguistik und der Literaturwissenschaft ein und dasselbe Gebiet ausmache, da es sich in allen Fällen um strukturelle Fragen handelt, die untersuchen, wie einzelne Teile in einer in einem abstrakten oder konkreten Raum ausgespannten Konfiguration im Verhältnis zueinander definiert werden. Das als Organismus verstandene Tier stellt somit eine Struktur dar, genau wie die Glieder eines Satzes oder die Atome eines Kristalls. Petitot plädiert auf diese Weise für eine Wiederaufnahme und eine Erweiterung des französischen Strukturalismus. Weil die Struktur sich damit beschäftigt, auf welche Weise Teile sich in einem Raum befinden, ist sie für Petitiot ein topologisches Phänomen, und daher wären die Katastrophentheorien und die Chaostheorie Hilfsmittel zur Begründung dieser neuen Strukturwissenschaft.(Raven, S. 219f)
Thermodynamik (Physik, Chemie): Wärmenlehre. Disziplin der Physik. deren Thema das Zusammenspiel der Wärme – einer besonderen Form der Energie – mit den übrigen Energieformen ist (von gr. therme: Wärme). (vgl. Raven, S. 233)
Übergang zum Chaos (Physik): Wenn ein System von klassischem (d.h. grundsätzlich vorhersagbarem) Verhalten zu chaotischem wechselt, spricht man von Übergang zum Chaos. (vgl. Raven, S. 237)
Unvorhersagbarkeit: In der modernen Naturwissenschaft studiert man Systeme, über die man aus verschiedenen Gründen keine genaue Vorhersage machen kann. Die Unvorhersagbarkeit muß daher in vielen Fällen grundsätzlicher Natur sein; sie ist kein Ausdruck des Unvermögens der Forscher oder ihrer Methoden. (vgl. Raven, S. 243)
Wissenschaftstheorie (Philosophie): Theorie über das Wesen der Wissenschaft, ihre Praxis und Gültigkeit. Das Wort bezeichnet sowohl eine bestimmte Theorie als auch das Studium aller Theorien und darf nicht mit ‚wissenschaftlicher Theorie‘ verwechselt werden. (vgl. Raven, S. 251)
Abundanz: Anzahl der Organismen in bezug auf einen Flächen- oder Rauminhalt
adult: erwachsen
Akal: Substratbezeichnung, Fein- und Mittelkies (Korngröße 0,2-2 cm)
Autökologie: Ökologie des Einzelorganismus
Äschenregion: Abschnitt eines Fließgewässers mit Äsche als Charakterfisch (Hyporhithral)
Barbenregion: Abschnitt eines Fließgewässers mit Barbe als Charakterfisch (Epipotamal).
Benthal: Bodenzone eines Gewässers
Benthon (Benthos): Gesamtheit der im Benthal lebenden Organismen (benthisch lebend) in Seen (Lithoral, Profundal) und Fließgewässern („Bodenfauna“).
Biomasse: Gewicht einzelner Organismen, Organismengruppen oder der zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Lebewesen je Flächen- oder Volumenseinheit einer Lebensstätten.
Biozönose: Lebensgemeinschaften
Brachsenregion: Abschnitt eines Fließgewässers mit Brachse als Charakterfisch (Metapotamal)
Chorlotop: Teillebensräume eines Gewässers, die sich beispielsweise über das Substrat differenzieren
Destruenten: Organismen, die tote organische Stoffe abbauen und mineralisieren (Überwiegend heterotrophe Bakterien und Pilze)
Detritus: Gesamtheit der toten organischen Partikel, die im Wasser schweben oder am Grund des Gewässers abgelagert sind.
Diversität: Mannigfaltigkeit (Artendiversität, Strukturdiversität)
Diversitätsindex: Maßzahl für die Diversität (Mannigfaltigkeit) einer Lebensgemeinschaft
dominant: vorherrschend
Dominanz: Relative Menge einer Art, bezogen auf eine Flächen- oder Raumeinheit
Drift: Die Gesamtheit der im fließenden Wasser suspendierten lebenden und toten, organischen und anorganischen Partikel. Als organische Drift werden nur die organischen Partikel, als organismische Drift nur die driftenden lebenden Organismen bezeichnet. Mengenangabe pro Zeiteinheit oder Wasserquantum.
Emergenz: Ausschlüpfen adulter Insekten, deren Larven im Wasser leben.
Epipotamal: Barbenregion
Epirhithral: Obere Forellenregion
eudominant: stark vorherrschend
euryök: Bezeichnung für Organismen, die Schwankungen lebenswichtiger Umweltfaktoren innerhalb weiter Grenzen ertragen.
eutroph: nährstoffreich
Furkationstyp: Flüsse mit verzweigtem Gerinne
Geschiebe: Die am Grund eines Fließgewässers rollend oder schiebend mitgeführten Steine, Kiese oder Sande mit einem Durchmesser > 0,63 mm
Grenzschicht: Strömungsarme Wasserschicht auf überströmten festen Substraten mit starker Verminderung der Fließgeschwindigkeit gegen die Substratoberfläche. Die Grenzschicht ist in Fließgewässern ein wichtiger Lebensraum für Organismen.
Habitat: Lebensraum einer Art (bei synökologischer Betrachtung: Synonym zu Biotop)
Hydrobiologie: Lehre von in den Gewässern lebenden Organismen. Hydrobiologie ist demnach sowohl ein Spezialgebiet der Limnologie (Organismen in Süßwasser) wie der Oceanologie (Organismen im Meer), aber nicht identisch mit Limnologie oder Oceanologie.
Hydrurus: Goldalgen
Hypopotamal: Kaulbarsch-Flunder-Region
Hyporhithral: Äschenregion
Indifferente Arten: keine ausgeprägte Präferenz bezüglich bestimmter lebensraumbestimmender Faktoren (z.B. Fließgeschwindigkeit)
juvenil: zur Jugendphase gehörend
katharobe Zone: Stärkste Verunreinigung
Kaulbarsch-Flunder-Region: Abschnitt eines Fließgewässers mit Kaulbarsch und Flunder als Charakterfisch
Konsumenten: Die Gesamtheit der tierischen Organismen in einem Lebensraum; so genannt, weil sie sich von vorgebildeten organischen Stoffen ernähren (die Primärkonsumenten von pflanzlicher Biomasse, die Sekundärkonsumenten von tierischem Material).
Kranal: Quellbereich eines Fließgewässers. Die darin lebenden Organismen bilden das Krenon, Biotop und Biozönosen Kranocoen.
laminare Strömung: Wasserbewegung, bei der Wassserteilchen parallel nebeneinander fließen
Limnologie: Lehre von stehenden und fließenden Gewässern auf dem Festland, soweit ihr Stoffhaushalt untersucht wird.
Lithal: Lebenraum auf Steinen
lithorheophil: Bezeichnung für Gewässer-Organismen, die vorzugsweise auf Steinen vorkommen und hohe Fließgeschwindigkeiten bevorzugen
Litoral: Der durchlichtete Gewässerbereich des Benthals bis zur Tiefengrenze der Netto-Primärproduktion (Kompensationstiefe); im See die mit Algen und höheren Pflanzen bewachsene Uferzone
Makrolithal: Substratbezeichnung, grobes Blockwerk, etwa kopfgroße Steine bis maximal 40 cm Durchmesser vorherrschend, mit variablen Anteilen von Steinen, Kies und Sand (Korngröße 20-40 cm)
Megalithal: Substratbezeichnung, Oberseite großer Steine und Blöcke, anstehender Fels, Korngröße > 40 cm)
Mesolithal: Substratbezeichnung, Faust- bis handgroße Steine mit variablem Kies- und Sandteil (Korngröße 6,3-20 cm)
Metapotamal: Brachsenregion
Metarhithral: Untere Forellenregion
Migration: Wanderung
Mikrorhithral: Substratbezeichnung, Grobkies (Taubenei- bis Kinderfaustgröße) mit Anteilen von Mittel- und Feinkies sowie Sand (Korngröße 2-6,3 cm)
Nahrungskette: Funktionelle Verknüpfung von Pflanzen, Pflanzenfressern, Tierfressern (Produzent-Primärkonsument-Sekundärkonsument-Endkonsument) mit Stoff- und Energietransport
Nekton: Organismen der Freiwasserzone mit aktivem Ortswechsel ohne Behinderung durch Wasserbewegung; in Seen nur die Fische
nivales Abflußregime: Abflußmaximum im Sommer (etwa Juni), Abflußminimum Winter
Obere Forellenregion: Abschnitt eines Fließgewässers mit Forellen als Charakterfisch (Epirhithral)
oligosaprobe Zone: geringe Verunreinigung
Ökosystem: Funktionelle Einheit von Lebewesen und ihrer Umwelt in einem ökologischen Raum. Das Ökosystem ist ein offenes System, aber durch Stoffkreisläufe zur Selbstreinigung befähigt. Ökosysteme sind nie scharf abzugrenzen und stellen immer nur funktionelle und strukturelle Schwerpunkte in der Biosphäre dar.
Pelagial: Freiwasserraum eines Gewässers. In einem Fluß oder Strom ist das Pelagial ständig in gerichteter Bewegung.
Pelal: Substratbezeichnung, Schlick, Schluff, Ton und Schlamm (Korngröße < 0,063 mm)
palophil: schlammliebend
Periphython: Pflanzlicher Aufwuchs auf Steinen, Pflanzen und anderen Substraten, überwiegend Algen, auch Bakterien und Pilze
Phythal: Der von Pflanzen gebildete Lebensbereich, der anderen Organismen als Wohn- und Aufenthaltsbereich dient
Plankton: Gesamtheit der im Freiwasserraum lebenden, mit den Wasserbewegungen passiv treibenden Organismen (Bakterienplankton, Phythonplankton und Zooplankton)
Pleuston: an oder auf der Wasseroberfläche schwimmende oder laufende größere Organismen
Potamal: Sommerwarme, sandig schlammige Zone eines Fließgewässers; die hier lebenden Organismen bilden das Potamal, Biotop und Biozönose das Potamocoen, Sommertemperatur über 20 Grad C
pontisch: Verbreitungsgebiet von Organismen, die im Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres vorkommen
pontokaspisch: Verbreitungsgebiet von Organismen, die im Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres, des Aralsees und des Kaspischen Meeres vorkommen
Produktion: Ganz allgemein ist Produktion aus der Sicht der Biologie der Zuwachs von Biomasse/Zeit. Primärproduktion ist der Zuwachs an phythotropher Biomasse unter biochemischer Speicherung von Strahlungsenergie. „Sekundärproduktion“ ist der Zuwachs an tierischer Biomasse durch Konsumption von organischen Energieträgern. Der Begriff Produktion sollte auf Primärproduktion eingegrenzt werden, Sekundärproduktion ist Konsumption.
Produzenten: Phythotrophe Organismen, Pflanzen, Cyanobakterien und Bakterien, die primär Strahlungsenergie bei der Bildung von Körpersubstanzen speichern.
Profundal: Sohlbereich
Psammal: Substratbezeichnung, Sand (Korngröße 0,063-2 mm)
Reproduktion: Vermehrung, Fortpflanzung
rezendent: zurücktretend
rheophil: Bezeichnung für Organismen, die an hohe Fließgeschwindigkeit angepaßt sind.
Rhithral: Sommerkalte, steinig sandige Zone eines Fließgewässers. Die hier lebenden Organismen bilden das Rhithron, Biotop und Biozönose das Rhithrocoen. Die Sommertemperaturen liegen unter 20 Grad C. Entspricht im wesentlichen der Salmonidenregion.
Salmonidenregion: Oberster Abschnitt eines Fließgewässers mit Salmoniden als Charakterfische
Saprobiesysteme: Eine Zusammenstellung von Organsimen, deren ökologischer Verbreitungsschwerpunkt (Vorkommen und Häufigkeit) in bestimmten Belastungszonen eines Vorfluters liegt und die für solche Belastungszustände daher eine Indikatorfunktion haben. Das Saprobiensystem wird im Verbund mit chemischen und biochemischen Indikatoren zur Charakterisierung der Gewässergüte herangezogen.
Selbstreinigung: Organismische Aktivität in einem Gewässer, durch die Fremdstolle abgebaut, mineralisiert und in den natürlichen Stoffkreislauf einbezogen werden, z. B. Abwasserinhaltsstoffe.
sessil: Bezeichnung für Organismen, die unfähig zu aktiver Fortbewegung sind
stagnophil: Bezeichnung für Pflanzen und Tiere, die niedrige Fließgeschwindigkeiten bevorzugen.
stenök: Bezeichnung für Organismen, die Schwankungen lebenswichtiger Umweltfaktoren nur innerhalb enger Grenzen ertragen
subrezendent: stark zurücktretend
Taxon: wissenschaftliche Bezeichnung für eine Gruppe von Lebewesen
Taxonomie: Lehre von der Klassifikation der Lebewesen
torrentikol: Bezeichnung für Organismen, die an äußerst hohe Fließgeschwindigkeiten angepaßt sind (Sturzbäche)
Trophie, Eutrophie: Trophie ist die Intensität der phytoautrophen Produktion, Eutrophierung ist demnach die Zunahme dieser Primärproduktion eines Gewässers durch natürliche oder künstliche Nährstoffsicherung.
Turbulente Strömung: Wasserbewegung, bei der die Wasserteilchen nicht parallel zueinander fließen (Querdurchmischung findet statt).
Untere Forellenregion: Abschnitt eines Fließgewässers mit Forelle als Charakterfisch
Inhaltsverzeichnis
Atkins, Peter William:Wärme und Bewegung, 1986 Auflage, Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH & Co.
Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth: Das ganz normale Chaos der Liebe1990 Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Briggs John, Peat F. David: Die Entdeckung des Chaos 1990 Auflage, München – Wien: Carl Hanser
Buber, Martin: Das Dialogische Prinzip 1994, 7. Auflage, Gerlingen: Verlag Lambert und Schneider
Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, Bundesministerium f. Umwelt, Jugend u. Familie, WWF Österreich: Das Buch der Flüsse 1998, Wien, Thienel Offsetdruck
Capra Fritjof, Steindl-Rast David: Wendezeit im Christentum 1994, 2. Auflage, Bern und München: Scherz Verlag
Capra, Fritjof: Das Tao der Physik 1986, 8. Auflage, Bern, München: Scherz Verlag
Capra, Fritjof: Wendezeit 1998, 6. Auflage, München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co KG
Ciompi, Luc: Die emotionalen Grundlagen des Denkens 1997, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Cramer, Friedrich: Der Zeitbaum 1993, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag
Erdmann, Alies: Humanitas rhythmica. Rhythmisch strukturierte Sinnesphänomene – eine Orientierungshilfe für die Ausbildung des Menschlichen? 1982 Auflage, Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann
Feuser, Georg: Behinderte Kinder und Jugendliche 1995, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Feuser, Georg: Frühe Entwicklungsstörungen und Dialog bzw. Dialogstörungen und frühe Entwicklung Mitschrift der Vorlesung im SS 1996, Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck
Fremdwörterbuch: Duden bearbeitet von Karl-Heinz Ahlheim 1966, Mannheim: Dudenverlag
Furrer, Hans: Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer 1991, Biel: Druckerei Schüler AG
Gleick, James: Chaos 1990, München: Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur
Goffmann, Erving: Stigma 1996, 12. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp
Hoeg, Peter: Der Plan von der Abschaffung des Dunkels 1995, München Wien: Carl Hanser Verlag
Jantsch, Erich: Die Selbstorganisation des Universums 1992, München: Carl Hansen Verlag
Jürgens Hartmut, Peitgen Heinz-Otto, Saupe Dietmar: Chaos und Fraktal 1989, Spektrum d. Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, 6900 Heidelberg
Konold, Werner: Naturlandschaft Kulturlandschaft 1996, Landsberg: comed verlagsgesellschaft AG & CO.KG
Kriz Jürgen, Lück E. Helmut, Heidbrink Horst: Wissenschafts- und Erkenntnistheorie 1990 2. Auflage, Hemsbach/Bergstraße, Druckhaus Beltz
Lewin, Roger: Die Komplexitätstheorie Hoffmann und Campe
Maturana Humberto R., Varela Francisco J. Der Baum der Erkenntnis 1987, Bern München: Scherz Verlag
Merz, Hans-Peter: Behinderung – verhindertes Menschenbild? 1994, Biel-Schweiz: Druckerei, Schüler AG
Raven, Ib: Chaos, Quarks und schwarze Löcher 1995, München: Verlag Antje Kunstmann GmbH
Schellenbaum, Peter: Abschied von der Selbstzerstörung 1987, Stuttgart : Kreuz-Verlag
Spitz, A. René: Vom Dialog 1988, München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co KG
Spitz, A. René: Vom Säugling zum Kleinkind
von der Schmitten, Inghwio:Schwachsinn in Salzburg 1985, Salzburg: Umbruch Werkstatt
von Lüpke Hans, Voß Reinhard: Entwicklung im Netzwerk1994, Pfaffenweiler: Centaurus- Verl.-Ges.
Vester, Frederic: Krebs – fehlgesteuertes Leben 1991, 5. Auflage, München: Deutscher Taschenbuchverlag
Watzlawick, Paul: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 1998, 24. Auflage, München: Piper Verlag
Weischedel, Wilhelm: Die philosophische Hintertreppe 1975, München: Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co. KG
Wolinsky, Stephan: Das Tao des Chaos 1996, Freiburg i. Br.: Verlag Alf Lüchow
Wolinsky, Stephan: Quantenbewußtsein 1996 2. Auflage, Freiburg i.Br.: Verlag Alf Lüchow
Feldenkrais, Moshe: DER MENSCH UND DIE WELT
Somatics/Magazine-Journal of the Bodily Arts and Sciences
Vol.LL., No.2, Frühjahr 1979, S. 43 – 46
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Hans-Erich Czetczok, Bielefeld
Tiroler Tageszeitung:
Freitag, 18. April 1997/Nr. 90; Innsbruck:
Schlüsselverlag J.S. Moser Ges.m.b.H.
Psychologie Heute:
Spetember 1998, 25. Jahrgang; Weinheim: Julius Bletz GmbH & Co. KG
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie:
Ausweisung naturnaher Fließgewässerabschnitte in Österreich
Vorstudie
Wien, 1993
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaftskataster:
Ausweisung Flußtypspezifischer Fließgewässerabschnitte in Österreich
Wien, Oktober 1996
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaftskataster:
Ausweisung Flußtypspezifischer Fließgewässerabschnitte in Österreich
Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet < 500 m2 ohne Bundesflüsse
Wien, Oktober 1998
Burtscher, Reinhard:
Bewegende Selbstorganisation
1997, Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität
| Name: | Gertrud Köck |
| geboren: | 3.3.1959 in Breitenwang |
| Schulische Ausbildung: | 1965 – 1970 Volksschule Kleinstockach1970 – 1974 Hauptschule Reutte
1974 – 1977 Handelsschule Reutte 1991 – 1993 Studienberechtigung 1193 – 1998 Studium: Pädagogik / gewählte Fächer 1995 Erste Diplomprüfung |
| Berufliche Entwicklung: | 1977 – 1981 Büroangestellte1981 – 1991 Familie / ehrenamtliche Tätigkeiten
seit 1993 ambulante Familienbetreuung bei der Jugendwohlfahrt in Reutte |
Quelle:
Gertrud Köck: Chaostheorie. Aspekte für die Pädagogik
Diplomarbeit zur Erlangung eines Magistragrades der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. eingereicht bei: a.o. Univ. – Prof. Dr. Volker Schönwiese Betreuung: Univ.-Vetr. Ass. Mag. Sigrid Köck-Hatzmann, am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. Breitenwang, März 1999
bidok – Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 20.11.2006